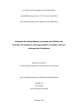Evaluation der Risikoprädiktion für postoperative Übelkeit und Erbrechen mit etablierten Vorhersagemodellen im Zeitalter moderner antiemetischer Prophylaxen
Postoperative Übelkeit und Erbrechen (PONV) gehört mit einer Inzidenz von 20-30% zu den häufigsten Beschwerden nach einer Narkose. In Hochrisikogruppen steigt diese auf bis zu 80% an. Die Einteilung von Patienten in Niedrig- und Hochrisikogruppen kann mithilfe des Apfel-Scores bzw. Koivuranta-Scores...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Postoperative Übelkeit und Erbrechen (PONV) gehört mit einer Inzidenz von 20-30% zu den häufigsten Beschwerden nach einer Narkose. In Hochrisikogruppen steigt diese auf bis zu 80% an. Die Einteilung von Patienten in Niedrig- und Hochrisikogruppen kann mithilfe des Apfel-Scores bzw. Koivuranta-Scores erfolgen. Diese Vorhersage- Scores werden anhand der Anzahl von zutreffenden Risikofaktoren berechnet und können zur Einschätzung des PONV-Risikos von Patienten genutzt werden. Der Apfel- Score (0-4 Punkte) bzw. Koivuranta-Score (0-5 Punkte) werden mithilfe der folgenden Risikofaktoren berechnet: „weibliches Geschlecht“, „PONV oder Kinetose in der Anamnese“, „Nichtraucherstatus“, „postoperativer Gebrauch von Opioiden“ bzw. „Operationsdauer über eine Stunde“.
Weder in der Studie von Apfel et al. noch in der von Koivuranta et al. erhielten die untersuchten Patienten prophylaktisch Antiemetika.
Ein Ziel dieser Studie ist daher zu untersuchen, wie sich die PONV-Inzidenzen verändern, wenn eine antiemetische Prophylaxe erfolgt und ob weiterhin ein messbarer Unterschied zwischen den Inzidenzen der Niedrig- und Hochrisikopatienten zu beobachten ist. Außerdem soll analysiert werden, ob eine präoperative Nutzung der Risikoscores in einem klinischen Setting, in dem alle Patienten eine multimodale antiemetische Prophylaxe erhalten, sinnvoll ist und welchen Patienten solch eine Prophylaxe zuteil werden soll.
Ausgewertet wurden die Daten von 2049 erwachsenen Patienten, die im Rahmen der P6NV-Studie erhoben wurden. Dies ist eine randomisierte, patienten- und beobachterverblindete Multicenterstudie, die eine P6-Stimulation zur Prophylaxe von Übelkeit und Erbrechen in der postoperativen Phase bei Patienten, die eine routinemäßige pharmakologische Prophylaxe erhalten, evaluieren soll.
Es konnte gezeigt werden, dass die meisten Patienten sowohl einen Koivuranta-Score als auch einen Apfel-Score von zwei bzw. drei Punkten hatten und während der Narkose zwei Antiemetika, meist Dexamethason und Granisetron, erhielten.
Sowohl im Aufwachraum (2 Stunden postoperativ) als auch auf der Station (24 Stunden postoperativ) wurde eine modifizierte Version der sog. PONV Intensity Scale (PIS) nach Wengritzky et al. erhoben, um die Häufigkeit von Erbrechen bzw. Würgen, sowie die Schwere, Art und Dauer der Übelkeit analysieren zu können.
Im Aufwachraum litten 10% der Patienten unter irgendeiner Form von Übelkeit und ca. 5% mussten mindestens ein Mal erbrechen oder würgen. Auf Station verdoppelten sich diese Zahlen auf knapp 20% bzw. 10%. Durch die Nutzung der Simplified postoperative nausea and vomiting impact scale (SPIS) nach Myles et al. wurde die Inzidenz des sog. klinisch relevanten PONVs berechnet. Diese betrug im Aufwachraum 1.0% und auf Station 2.2%. Anzumerken und zu kritisieren ist, dass der Schwellenwert für klinisch relevantes PONV von den Autoren recht hoch gewählt wurde, weshalb nur wenige Patienten dieser Definition entsprachen.
Die PONV-Inzidenzen im Aufwachraum und auf Station wurden aufgeteilt nach Anzahl der zutreffenden Risikofaktoren gemäß dem Apfel- bzw. Koivuranta-Score untersucht. Es konnte bei beiden Scores gezeigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit sowohl für frühes als auch für spätes PONV linear zunimmt, je mehr Risikofaktoren erfüllt werden. Dies stimmt mit den Ergebnissen der ursprünglichen Publikationen von Koivuranta et al. und Apfel et al. überein.
Auch fiel auf, dass Patienten mit klinisch relevantem PONV meist einen hohen Apfel- bzw. Koivuranta-Score hatten.
Diese Ergebnisse zeigen, dass die präoperative Erhebung der Risikoscores in einem klinischen Setting, in dem alle Patienten eine umfassende antiemetische Prophylaxe erhalten, sinnvoll ist. Die Inzidenzen wurden durch die Prophylaxe absolut zwar gesenkt, aber die Hochrisikopatienten litten trotzdem verhältnismäßig oft unter PONV. Diese Erkenntnis weist darauf hin, dass die gewählte Prophylaxe für diese Patientengruppe nicht ausreichend war.
Zur Reduktion von PONV können verschiedene Maßnahmen angewendet werden. Zunächst sollte für alle Patienten präoperativ das PONV-Risiko ermittelt werden. Auch soll immer über grundlegende Maßnahmen zur Risikominimierung nachgedacht werden. Dazu gehört das Vermeiden von volatilen Anästhetika und Lachgas, das Einsparen von Opioiden sowohl intra- als auch postoperativ und eine adäquate Hydrierung des Patienten. Außerdem soll, wenn möglich, eine Regionalanästhesie gegenüber einer Vollnarkose bevorzugt und Propofol im Rahmen einer totalen intravenösen Anästhesie (TIVA) für die Narkoseführung genutzt werden. Alle Patienten sollen eine antiemetische Prophylaxe erhalten, welche je nach Anzahl der Risikofaktoren eskaliert wird. Patienten ohne erhöhtes Risiko sollen ein Antiemetikum erhalten. Bei ein bis zwei Risikofaktoren sollen zwei und ab drei Risikofaktoren mindestens drei Antiemetika mit unterschiedlichen Wirkmechanismen appliziert werden.
Ein Auftreten von PONV sollte zügig mit einem Antiemetikum einer anderen Wirkstoffklasse therapiert werden. |
|---|---|
| Umfang: | 129 Seiten |
| DOI: | 10.17192/z2024.0181 |