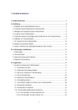Stellenwert der Tympanoskopie im Rahmen der Hörsturzbehandlung. Eine Studie am Patientengut der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Kopf- und Halschirurgie am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus
Bei 59 Patienten (40 Männer; 19 Frauen) mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren, die eine plötzliche einseitige Schallempfindungsschwerhörigkeit erlitten hatten und entweder anamnestisch Hinweise auf das Vorliegen einer Perilymphfistel, eine hochgradige Hörminderung oder aber auf eine medikamentö...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2019
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Bei 59 Patienten (40 Männer; 19 Frauen) mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren, die eine plötzliche einseitige Schallempfindungsschwerhörigkeit erlitten hatten und entweder anamnestisch Hinweise auf das Vorliegen einer Perilymphfistel, eine hochgradige Hörminderung oder aber auf eine medikamentöse Behandlung hin keinen Hörerfolg zeigten, wurde eine Tympanoskopie mit Abdichtung des runden und ovalen Fensters vorgenommen.
Der prozentuale Hörverlust nach dieser Operation erwies sich als signifikant geringer als vor dem operativen Eingriff (26,4% Besserung). Dabei stand der Hörgewinn in keinem signifikanten Zusammenhang zum Ausgangshörverlust .
Weder das Geschlecht bzw. Alter der Erkrankten, die otologische Vorerkrankungen, eine zuvor ambulant durchgeführte Vorbehandlung, das gleichzeitige Vorliegen von Schwindel wie auch die Angabe einer für das Entstehen einer Perilyphfistel typischen „Auslösesituation“ hatten einen statistisch relevanten Einfluss auf das Ausmaß des Hörgewinns nach der Tympanoskopie. Dem steht gegenüber, dass Patienten mit Schwindel um 15% geringere Hörgewinne aufwiesen als jene Erkrankten ohne eine Gleichgewichtsstörung als Begleitsymptom.
Auch die erst mehr als 10 Tage nach der stationären Aufnahme Operierten zeigten noch gute Chancen auf eine Erholung ihres Gehörs.
Weder ein neben dem Hörverlust gleichzeitig vorliegender Schwindel, die Tatsache einer vollkommenen Ertaubung noch die Angabe einer „typischen Auslösesituation“ unmittelbar vor dem Hörverlust erwiesen sich als verlässliche Parameter in der Vorhersage einer Perilymphfistel bzw. des Bestehens einer Fissur an der knöchernen Schale der Cochlea.
Es wurden gesondert die Daten der Subgruppen „Ertaubte und Nicht - Ertaubte“, „Patienten mit gutem (>75%) und unzureichendem (<25%) Hörgewinn“ sowie „mit und ohne Schwindel“ einander gegenübergestellt, ohne dass sich signifikante Unterschiede bzgl. ihrer anamnestischen Daten bzw. erhobenen Befunde herausarbeiten ließen.
Im Rahmen einer Metaanalyse konnten die Daten von 576 Patienten aus 10 Studien, bei denen unter vergleichbaren Indikationen eine Tympanoskopie durchgeführt worden war, mit den von erzielten Ergebnissen verglichen werden. Einer Besserungs- bzw Erholungsrate des Gehörs standen die von uns erzielten 41% denen von 49% aus der Literatur gegenüber. Hinsichtlich der Komplikationsrate mit Hörverschlechterungen nach der Operation lagen wir mit 3% gegenüber den aus den Studien abgeleiteten Werten mit 13% deutlich günstiger. Hinsichtlich der anamnestischen Angaben und den erhobenen HNO-Befund unterschieden sich unsere Resultate nicht nennenswert von denen aus der Literatur.
Die Tympanoskopie scheint sich bei vergleichbarer Indikation als „salvage-therapy“ neben der medikamentösen Instillation von Corticosteroiden („salvage-therapy“) durchaus zu bewähren. |
|---|---|
| Umfang: | 79 Seiten |
| DOI: | 10.17192/z2019.0296 |
 Publikationsserver
Publikationsserver