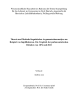Theorie und Methode linguistischer Argumentationsanalyse am Beispiel von Impfdiskursen. Ein Vergleich der parlamentarischen Debatten von 1874 und 2022
Die gegen Ende 2019 einsetzende pandemische Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 gehört zeitgeschichtlich zu den einschneidendsten und alle Lebensbereiche beeinflussenden Ereignissen der letzten Jahrzehnte. Im Kontext der Corona-Pandemie wurde im Jahr 2022 im Deutschen Bundestag eine Debatte über...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Arbeit |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Die gegen Ende 2019 einsetzende pandemische Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 gehört zeitgeschichtlich zu den einschneidendsten und alle Lebensbereiche beeinflussenden Ereignissen der letzten Jahrzehnte. Im Kontext der Corona-Pandemie wurde im Jahr 2022 im Deutschen Bundestag eine Debatte über eine Corona-Impfpflicht geführt. Diese Debatte zeichnete sich durch verschiedene, kontroverse Standpunkte aus, die im politischen Kontext, aber auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Impfpflicht aufeinandertrafen. Dass die vorgebrachten Pro- und Contra-Argumente nicht neu sind, wird deutlich, wenn man sich historische Impfdiskurse des 19. Jahrhunderts anschaut. In der vorliegenden Arbeit bilden mit der Reichstagsdebatte um das Reichsimpfgesetz 1874 und der Orientierungsdebatte im Bundestag um die SARS-CoV-2-Impfpflicht bilden zwei thematisch ähnliche Diskursausschnitte den Untersuchungsgegenstand, wodurch sowohl diskursgeschichtliche Aspekte als auch das Interesse der linguistischen Forschung an kontroversen Diskursen abgedeckt werden. Die konkreten Ziele dieser explorativ-qualitativen Arbeit bestehen darin, (1) die streitfragenbe-zogene diskursive Agonalität in beiden Debatten anhand der Analyse von Argumentationen, Argumentationsmustern und kommunikativen Strategien zu rekonstruieren sowie (2) durch einen Vergleich auf der Ebene der Argumentationsmuster bzw. -topoi wie auch der kommunikativen Strategien Gemeinsamkeiten und Eigenheiten beider Diskursausschnitte auf Basis eines diskursanalytischen und politolinguistischen Zugangs herauszuarbeiten. Das Analysekorpus besteht aus insgesamt 161 Debattenreden, wovon 48 kriteriengeleitet für die konkrete Analyse ausgewählt wurden. Dabei wurde etwa herausgearbeitet, dass ein in beiden Diskursausschnitten einige Teilaspekte des modernen Prinzips der Verhältnismäßigkeit von allen Akteur*innen in beiden Debatten im Sinne eines Wertekonsens anerkannt wird. In Bezug auf Freiheitskonzepte liegen insofern kontextbedingte Differenzen vor, als in der Bundestagsdebatte die agonalen Grundfiguren des Primats der kollektiven Freiheit auf der einen sowie die Grundfiguren des Primats der individuellen Freiheit und des paternalistischen Staates auf der anderen Seiten prägend sind, während die Freiheitskonzepte der Reichstagsredner stärker vom zeitgenössischen Kulturkampf motiviert sind. Augenscheinlich sind auch die Unterschiede beim Gebrauch des Persuasionstopos, die gleichzeitig die systemischen Differenzen zwischen öffentlich-politischem Sprachhandeln in (repräsentativen) Demokratien und in einer konstitutionellen Monarchie wie dem Kaiserreich veranschaulichen (überzeugen vs. überreden). Hierbei ist zu konstatieren, dass es Aufgabe weiterer Forschung sein könnte, eine weitere Differenzierung des informativ-persuasiven Sprachfunktionsmusters vorzunehmen hinsichtlich des Freiheits- und Manipulationsgrades vorzunehmen. Entsprechende Funktionsmuster könnten wie folgt bezeichnet werden: die aufklärend-persuasive Sprachfunktion, die paternalistisch-persuasive Sprachfunktion und die indoktrinativ-propagandistische Sprachfunktion. Hinsichtlich der rekonstruierten Kommunikationsstrategien hervorzuheben, dass in beiden Debatten von sowohl Befürworter*innen als auch Gegner*innen die Strategien der Eigenprofilierung, der (teils stärker) polarisierenden Gegner*innenabwertung und der Abwertung bzw. Aufwertung des Images der sich in der Minderheit vorfindenden Teile der Bevölkerung, die die Corona- bzw. die Pockenimpfung ablehnen, im Vordergrund stehen. Zudem sticht hervor, dass sowohl das Zentrum (Reichstagsdebatte) als auch die Union (Bundestagsdebatte) eine Strategie der kalkulierten Ungewissheit durch Infragestellung der zur Verfügung stehenden Daten verfolgen, um die jeweiligen Gesetzesvorhaben zu delegitimieren. Eine Prolongierungsstrategie ist ausschließlich bei den Befürwortern des Reichsimpfgesetz erkennbar, während alle Akteur*innen in der Debatte um die SARS-CoV-2-Impfpflicht um eine teils schwächere, teils stärkere Distanzierung von den bisherigen pandemiepolitischen Maßnahmen bemüht sind. |
|---|---|
| DOI: | 10.17192/ed.2024.0001 |
 Publikationsserver
Publikationsserver