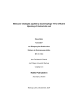Molecular strategies applied by bacteriophage T4 for efficient hijacking of Escherichia coli
Bacteriophages are bacterial predators that serve as excellent models to study host-pathogen interactions and hold significant potential for industrial and medical applications. These include the utilization of bacteriophages as alternatives to antibiotics in combating multi-resistant bacterial stra...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Bakteriophagen sind Viren von Bakterien, die nicht nur als hervorragende Modelle für die Untersuchung von Wirt-Pathogen-Interaktionen dienen, sondern auch ein erhebliches Potenzial für industrielle und medizinische Anwendungen haben. Dazu gehören der Einsatz von Bakteriophagen als Alternative zu Antibiotika bei der Bekämpfung multiresistenter Bakterienstämme, deren Nutzung für die Kontrolle mikrobieller Gemeinschaften und die Entwicklung von Phagen für spezifische Diagnosezwecke. Um das vollständige Potenzial der Phagen für medizinische und biotechnologische Anwendungen zu entfalten, ist ein umfassendes Verständnis der zugrundeliegenden Infektionsmechanismen von entscheidender Bedeutung. Der T4 Phage ist einer der Modell-Bakteriophagen und seine Infektion von Escherichia coli ist eine der am besten untersuchten Bakterium-Bakteriophagen-Interaktionen. Die Erforschung der molekularen Mechanismen der T4 Infektion hat maßgeblich zu unserem heutigen Verständnis der grundlegenden Prinzipien der Molekularbiologie beigetragen. Grundlegende Konzepte wie die DNA als Bauplan des Lebens, Prinzipien der Molekulargenetik, Evolutionsmechanismen von Phagen und vieles mehr wurden durch die Forschung an T4 Phagen entdeckt. Darüber hinaus sind viele Proteine der T4-Phagen zu unverzichtbaren Schlüsselwerkzeugen in molekularbiologischen Labors geworden. Trotz des umfangreichen Wissens, das bei der Erforschung des T4 Phagen gewonnen wurde, sind zahlreiche Aspekte seines Infektionsprozesses nach wie vor ungelöst. Während etwa die Hälfte der T4-Proteine mit spezifischen Funktionen in Verbindung gebracht wurden, ist die Rolle der übrigen 45 % der T4-Proteine noch unerforscht. Allein diese Wissenslücke macht deutlich, dass unser molekulares Verständnis der T4 Phageninfektion und der eingesetzten Strategien, die dem Phagen eine effiziente Infektion ermöglichen, noch lange nicht vollständig ist. Daher wurden eine grundlegende Verbesserung unseres Verständnisses der T4 Phageninfektion auf molekularer Ebene und die Aufdeckung bisher unerforschte Infektionsmechanismen als Ziele dieser Dissertation gesetzt. In Kapitel II wird eine Multi-Omics-Studie beschrieben, die eine zeitliche Auflösung einer Infektion von E. coli mit T4 Phagen auf molekularer Ebene bereitgestellt hat. Das Transkriptom und das Proteom von E. coli und T4Phagen wurden während der gesamten Infektion analysiert. Dies ermöglichte die Identifizierung von zeitlichen Genexpressionsmustern für Transkripte des T4 Phagen. Bei bestimmten viralen Genen wurde eine Entkopplung von Transkriptions- und Translationsprozessen observiert. Die Transkriptom- und Proteomanalysen von E. coli ergaben einen allgemeinen Abbau der Wirts-Transkripte und die Erhaltung der Wirtsproteine. Zusätzlich liefert diese Studie erstmals Einblicke in die molekulare Kinetik der T4 Phageninfektion. Die Ergebnisse deuten stark auf die Existenz zusätzlicher, unerforschter Infektionsregulationsmechanismen hin, die eine differenzielle Degradation von Wirts- und Phagentranskripten ermöglichen und überdies eine bisher unbekannte Entkopplung von Transkription und Translation für zahlreiche Phagengene begründen. Eine mögliche Erklärung für die differenzielle RNA Degradation und damit die Unterscheidung zwischen bakteriellen und viralen Transkripten während der T4 Infektion könnte das Vorhandensein von RNA-Modifikationen sein. Zusätzlich würde dieses Phänomen eine fundierte Erklärung für die beobachtete Entkopplung von Transkription und Translation für einige T4-Phagengene liefern. Kapitel III fasst den aktuellen Wissensstand zum bakteriellen Epitranskriptom zusammen, wobei der Schwerpunkt auf mRNA-Modifikationen liegt. Die bekannten Proteine, die RNA Modifikationen einfügen, erkennen oder entfernen können, werden zusammen mit Techniken zur Identifizierung und Untersuchung spezifischer RNA Modifikationen diskutiert. Diese Arbeit zeigt eine erhebliche Wissenslücke in Bezug auf RNA Modifikationen in bakterieller mRNA, ihre Modulatoren und ihre biologische Bedeutung auf. Während wenige Studien bereits Erkenntnisse über das bakterielle Epitranskriptom sammeln konnten, ist das Epitranskriptom von Bakteriophagen bisher hingegen unerforscht. In Kapitel IV wird das aktuelle Wissen über die RNA-Modifikation in Bakterien genutzt, um Hypothesen darüber aufzustellen, wie einige der bakteriellen und viralen Enzyme das Epitranskriptom von Bakteriophagen während der Infektion formen und modulieren könnten. Um die biologische Rolle potenzieller Infektionsregulatoren aus dem Repertoire des T4-Phagen zu erforschen, muss untersucht werden, wie ihre Abwesenheit oder ihre Inaktivität die Phageninfektion beeinflusst. Dies erfordert jedoch effiziente Werkzeuge für die Phagenmutagenese. CRISPR-Cas ist in dieser Hinsicht ein vielversprechendes molekularbiologisches Werkzeug für präzises Genome-Engineering, jedoch wird seine Effektivität für die Mutagenese von T4 Phagen durch abundante Modifikationen der T4 DNA stark beeinträchtigt. In Kapitel V wird ein Ansatz vorgestellt, der eine effiziente zeitliche Reduzierung der T4 Phagen-DNA-Modifikationen ermöglicht. Dadurch wird eine effiziente CRISPR-Cas-basierte Mutagenese von T4 Phagen ermöglicht. Darüber hinaus erlaubt dieses System auch die Untersuchung der Rolle von DNA Modifikationen bei der Phageninfektion und hat das Potenzial auf andere Phagen ausgeweitet zu werden. Kapitel VI befasst sich mit der T4 ADP-Ribosyltransferase ModB und zeigt, dass ModB nicht nur NAD als Substrat akzeptiert, sondern auch NAD-RNA. Auf diese Weise ist es ModB möglich eine neuartige post-translationale Modifikation, genannt RNAylierung, durchzuführen. Die Katalyse der RNAylierung durch ModB wurde sowohl in vitro als auch in vivo nachgewiesen. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass ModB mehrere E. coli Proteine, darunter die ribosomalen Proteine S1 und L2, RNAyliert. In diesem Kontext wurden die biologische Rolle und die molekularen Mechanismen der RNAylierung untersucht. Zusätzlich wurde eine T4 Phagenmutante mit einer katalytisch inaktiven Variante der ADP-Ribosyltransferase ModB erzeugt, um die Auswirkungen der katalytischen Aktivität auf die Phageninfektion und den Phänotypen zu untersuchen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass diese Arbeit zum besseren Verständnis der Infektion von E. coli durch T4 Phagen beiträgt, indem sie Einblicke in die zeitliche Organisation molekularer Abläufe der Infektion, die Auswirkungen von viralen DNA Modifikationen auf den Phänotypen der Phagen und die Entdeckung der RNAylierung – eine neuartige posttranslationale Proteinmodifikation – liefert. Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse legen auch den Grundstein für den Transfer in die Anwendung. Insbesondere das Verständnis der zeitlichen Organisation der Phagengenexpression ist für die Erzeugung synthetischer Phagen oder die Anpassung der bereits existierenden Phagen für spezifische Anwendungen von wesentlicher Bedeutung. Weiterhin kann die in dieser Arbeit entwickelte und vorgestellte Mutagenesestrategie effizient eingesetzt werden, um solche Phagen mit verbesserten Funktionen zielgerichtet zu erzeugen. Außerdem erweitert die Entdeckung der RNAylierung das Arsenal der von T4-Phagen abgeleiteten molekularen Werkzeuge. Die RNAylierung könnte in der synthetischen Biologie für die Entwicklung neuartiger künstlicher zellulärer RNA-Protein-Konstrukte eingesetzt werden und eröffnet somit neue Möglichkeiten für die Zukunft von RNA-basierten Therapeutika. Insgesamt erweitert diese Studie unser Verständnis der molekularen Mechanismen, die einer effizienten T4-Phageninfektion zugrunde liegen, und unterstreicht, dass das Entdeckungspotenzial der T4-Phagenforschung noch lange nicht ausgeschöpft ist.
 Publikationsserver
Publikationsserver