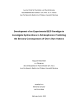Development of an Experimental EEG Paradigm to Investigate Dysfunctions in Schizophrenia: Predicting the Sensory Consequences of One’s Own Actions
Background: Prediction mechanisms are crucial for efficient perception of the environment and ourselves as well as for discrimination between self-generated and external changed situations. Known as the internal forward model, an efference copy of the motor plan prepares the sensory areas for the r...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Hintergrund: Vorhersagemechanismen sind für die effiziente Wahrnehmung der Umwelt und uns selbst wie auch für die Unterscheidung zwischen selbst- und fremderzeugten Situationen unerlässlich. Im Rahmen des internen Vorwärtsmodells bereitet eine Efferenzkopie des motorischen Handlungsplans die sensorischen Areale auf das reafferente Feedback vor. Bei einer Übereinstimmung zwischen dem vorhergesagten und tatsächlichen sensorischen Feedback kann die weitere Verarbeitung gedämpft werden. Dies zeigt sich sowohl in supprimierten N1-ERP Amplituden im EEG wie auch in abgeschwächter Intensitätswahrnehmung in Verhaltensdaten. Durch diesen Mechanismus können selbsterzeugte Handlungen „dem Selbst“ korrekt zugeordnet werden, während fremderzeugte Handlungen den sensorischen Kortex nicht mit einer Efferenzkopie vorbereiten können und damit als fremd erkannt werden. Fehlfunktionen in Vorhersagemechanismen für selbsterzeugte Handlungen resultieren in einer Unstimmigkeit im internen Vorwärtsmodell, was zur Zuordnung als fremderzeugte Handlung als auch zu abnormen neurophysiologischen und Verhaltenskorrelaten führt. Dies wird als Ursache für verschiedene positive Symptome der Schizophrenie wie sensorische Halluzinationen und Passivitätsphänomene angenommen. Hypothesen/Zielsetzung: Im ersten Teil der Studie untersuchten wir auf Efferenzkopie basierende Vorhersagen in einem umfangreichen Knopfdruckexperiment bei gesunden Probanden. Wir stellten die Hypothese auf, dass die Analyse einer ausgewählten Anzahl von visuellen Versuchen mit der gleichen Intensität ausreicht, um eine N1-ERP-Suppression unter aktiven Bedingungen zu zeigen. Wir erwarteten, dass der zweite Stimulus unter aktiven Bedingungen signifikant häufiger als intensiver wahrgenommen wird. Mit dem Hauptziel, ein optimiertes und für Patienten geeignetes Experiment zu entwickeln, stellten wir die Hypothese auf, dass nach einer Änderung des Versuchsaufbaus deutlichere N1-ERP- und Verhaltenseffekte im zweiten Teil unserer Studie auftreten, indem wir die Zeitintervalle veränderten, die Gesamtdauer verkürzten, das Präsentationsformat änderten und uns nur auf die visuelle Bedingung konzentrierten. Schließlich nahmen wir an, dass die Teilnehmer in der Lage sind, das optimierte Experiment gut zu lösen. Wir erwarteten, dass sich dies durch den Fragebogen nach dem Experiment feststellen lässt. Material und Methoden: Die Teilnehmer drückten aktiv oder passiv eine Taste, woraufhin visuelle Reizen auf einem Computerbildschirm angezeigt wurden. Anschließend beurteilten sie, ob der erste oder zweite Reiz heller war, indem sie eine der definierten Tasten drückten. Während der gesamten Dauer der Experimente wurde ein EEG aufgezeichnet. Die Teilnehmer wurden gebeten, einen Fragebogen über das optimierte Experiment auszufüllen, um dessen Eignung zu bewerten. Ergebnisse: In beiden Experimenten fanden wir bei gesunden Probanden signifikant kleinere N1-Spitzenwerte in aktiven als in passiven Versuchen. Der Unterschied zwischen den beiden Experimenten selbst war nicht signifikant. Die Verhaltensdaten zur Intensitätswahrnehmung zeigten keinen signifikanten Unterschied, weder in den einzelnen noch im Vergleich der beiden Experimente. Bei Patienten mit Schizophrenie fanden wir keine signifikanten Ergebnisse für das optimierte Experiment. Sowohl Patienten als auch gesunde Probanden waren in der Lage, das optimierte Experiment gut durchzuführen, was anhand des Fragebogens nach dem Experiment beurteilt wurde. Diskussion: Unsere elektrophysiologischen Ergebnisse stehen im Einklang mit früheren Studien an gesunden Probanden. Wir konnten zeigen, dass die Analyse einer ausgewählten Anzahl von visuellen Versuchen mit der gleichen Intensität ausreicht, um eine N1-ERP-Suppression unter aktiven Bedingungen im umfangreichen Experiment zu zeigen. Wider Erwarten fanden wir für die Verhaltensaufgabe keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Bedingungen. Dies steht im Gegensatz zu dem Verständnis der sensorischen Dämpfung, dass selbst initiierte Handlungen als weniger intensiv wahrgenommen werden als fremderzeugte Handlungen. Weitere Optimierungen und Studien sind erforderlich, um robustere Effekte für das visuelle System zu zeigen. Die Entwicklung einer EEG-Studie, die für Patienten mit Schizophrenie geeignet ist, war jedoch im Hinblick auf die Daten des Post-Experiment-Fragebogens erfolgreich. Schlussfolgerung: Zusammenfassend konnten wir Evidenz für den elektrophysiologischen Mechanismus im visuellen System, nicht aber für die Verhaltensaufgabe zeigen. Mittels Post-Experiment-Fragebogen konnten wir die Eignung des optimierten experimentellen Versuchsaufbaus für Patienten zeigen, dessen Entwicklung unser Hauptziel war, um Funktionsstörungen bei Schizophrenie zu untersuchen. Weitere Studien mit einer größeren Patientenstichprobe sind erforderlich, um mehr Einblick in die Psychopathologie und die beeinträchtigten Vorhersagemechanismen im visuellen Bereich bei Schizophrenie zu erhalten.
 Publikationsserver
Publikationsserver