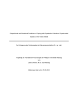Dispositional and Situational Predictors of Coping with Expectation Violations: Experimental Studies on the ViolEx Model
Expectations are cognitions that are formed from past experiences, influence current behavior, and anticipate future events (Roese & Sherman, 2007). Thus, expectations should be accurate in order to effectively guide behavior (Panitz et al., 2021). However, some events cannot be predicted with c...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Erwartungen sind Kognitionen, die sich aus vergangenen Erfahrungen bilden, gegenwärtiges Verhalten beeinflussen und zukünftige Ereignisse antizipieren (Roese & Sherman, 2007). Somit sollten Erwartungen zutreffend sein, um Verhalten möglichst effektiv zu steuern (Panitz et al., 2021). Manche Ereignisse lassen sich jedoch nicht mit Sicherheit vorhersagen und daher sind Erwartungen teilweise unzutreffend. Insbesondere Bildungserwartungen sind oft überoptimistisch und somit anfällig für Erwartungsverletzungen (Carolan, 2017). Nach dem ViolEx Modell entstehen situationsspezifische Erwartungen aus generellen Annahmen, wie zum Beispiel dem akademischen Selbstkonzept. Stimmt das Ergebnis einer Situation nicht mit den Erwartungen überein, können Individuen unterschiedlich damit umgehen. Coping kann sowohl antizipatorische Reaktionen wie Assimilation (Verhalten wird darauf ausgerichtet, Erwartungen in Zukunft zu bestätigen) auslösen, oder aber zu Immunisierung (Verleugnung, Devaluation, oder Ignorieren von Erwartungsverletzungen) oder Akkommodation (Erwartungsveränderung/-destabilisierung) führen (Gollwitzer et al., 2018; Panitz et al., 2021). Ob Erwartungen beibehalten oder verändert werden hängt stark von den Kosten und dem Nutzen der jeweiligen Coping- Strategie ab, insbesondere wenn akkurate Erwartungen einem positiven Selbstkonzeptes gegenüberstehen. Sowohl individuelle Unterschiede in der Persönlichkeit als auch situationale Unterschiede der Erwartungsverletzung können Bewältigung beeinflussen (Panitz et al., 2021). Hinsichtlich individueller Unterschiede besteht vermutlich eine situationsübergreifende Tendenz, auf Erwartungsverletzungen mit einem bestimmten Coping-Muster zu reagieren. Weiterhin ist anzunehmen, dass Individuen mit einem höheren Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit (NCC) eindeutige Antworten bevorzugen (Kruglanski & Webster, 1996). Dies führt zu einer Verzerrung zugunsten bestehenden Wissens und Erwartungen und somit vermutlich zu stärkerer Erwartungspersistenz trotz diskrepanter Informationen (Dijksterhuis et al., 1996). Jedoch sind auch Individuen mit höherem NCC daran interessiert, zukünftige Erwartungsverletzungen zu vermeiden, weshalb Copingtendenzen über Situationen hinweg variieren können und stark mit situationalen Charakteristiken wie der Valenz der Erwartungsverletzung zusammenhängen. Positive und negative Valenz der Erwartungsverletzung führte zuvor zu Ergebnissen, die den überoptimistischen Erwartungen im Bildungskontext ähneln: Positive Valenz führte zu mehr Akkommodation (Entstehen überoptimistischer Erwartungen) und negative Valenz führte zu mehr Immunisierung (Schutz des akademischen Selbstkonzepts und Bestehen überoptimistischer Erwartungen; e.g., Garrett & Sharot, 2017). Diese optimistische Verzerrung kann auch beeinflussen, wie mit (un)kontrollierbaren Erwartungsverletzungen umgegangen wird, wobei mit höherer Kontrollierbarkeit stärkere Assimilation und mit niedrigerer Kontrollierbarkeit mehr Immunisierung einhergehen sollte (Bhanji et al., 2016). Zudem sollten Erwartungen nach gängigen Lerntheorien zum Ausmaß von Erwartungsverletzungen besonders dann verändert werden, wenn die Abweichung von der Erwartung besonders signifikant ist, während bei geringen Diskrepanzen stärkere Immunisierung folgen sollte (Rescorla & Wagner, 1972). In dieser Doktorarbeit soll das Wissen über Prädiktoren und deren Interaktion im Umgang mit Erwartungsverletzungen erweitert werden, um theoretisch das ViolEx Modell zu evaluieren und praktisch Risikofaktoren für einen dysfunktionalen Umgang mit Bildungserwartungen zu erkennen. In der ersten Studie wurden dazu mehrere dispositionelle und situationale Prädiktoren eingeschlossen, und N = 439 Teilnehmende erhielten in einem Wörterrätsel standardisierte, erwartungsverletzende Rückmeldungen. Unsere Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass dispositionelle Präferenzen situationales Coping vorhersagen, zudem fanden wir aber Ergebnisse entgegen der Lerntheorien zum Ausmaß der Erwartungsverletzung, eine optimistische Verzerrung nur für negative Valenz, und stark kontextabhängige Effekte von NCC, welches sowohl Assimilation als auch Akkommodation vorhersagte. Daher haben wir in der zweiten Studie Valenz und NCC genauer untersucht, und die Ergebnisse von N = 268 Teilnehmenden replizierten und erweiterten unsere vorherigen Erkenntnisse: ein höherer NCC führte erneut zu mehr Akkommodation und Assimilation, aber nur bei negativer Valenz der Erwartungsverletzung. Da die bisherigen Studien optimistische Verzerrungen nur für negative, aber nicht für positive Valenz finden konnten, versuchten wir in der dritten Studie mit Fallvignetten bei N = 249 Studierenden durch den Einschluss von Kontrollierbarkeit und Selbstwerterhöhung die optimistische Verzerrung besser zu verstehen. Negative Valenz führte besonders dann zu Erwartungspersistenz, wenn die Erwartungsverletzung unkontrollierbar war und bei positiver Valenz kommt es unter verstärkter Selbstwerterhöhung zu Akkommodation. Die Studien bestätigen, dass Bewältigung von Erwartungsverletzungen stark von dispositionellen und situationalen Charakteristiken abhängt. Unsere Ergebnisse zeigen, dass im Bildungskontext über verschiedene Situationen hinweg der Schutz des akademischen Selbstkonzepts und der Bildungserwartungen stärker wiegt als die Akkuratheit von Erwartungen. Somit besteht bei Bildungserwartungen trotz gegenteiliger Evidenz durch Assimilation und Immunisierung eine starke Persistenz. Dies kann als adaptiv gesehen werden, so lange es dadurch in Zukunft nicht zu häufigen Erwartungsverletzungen kommt und insbesondere so lange die Situation kontrollierbar ist. Aber bei Vorliegen einer höheren NCC-Disposition zeigen Individuen sowohl mehr Assimilation als auch Akkommodation. Der oft als konträr betrachtete Zusammenhang beider Strategien könnte im Bildungskontext eine andere Bedeutung haben und einen adaptiven Mittelweg zwischen zutreffenden Erwartungen und einem positiven Selbstkonzept darstellen.
 Publikationsserver
Publikationsserver