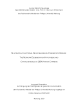Multimodal Functional Neuroimaging in Parkinson's Disease: The Network Degeneration Hypothesis and Characteristics in GBA Variant Carriers
Parkinson’s disease is a neurodegenerative disorder with distinct clinical and histopathological features. It is defined by asymmetric hypokinesia, rigidity, resting tremor, degeneration of nigrostriatal dopaminergic projections and α-synuclein deposits spreading slowly towards the cerebral cortex....
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Die Parkinson-Erkrankung ist ein neurodegeneratives Syndrom mit charakteristischen klinischen und histopathologischen Merkmalen. Sie ist gekennzeichnet durch asymmetrische Bewegungsstörung, Degeneration nigrostriataler dopaminerger Projektionen und α-Synukleinablagerungen, welche sich langsam in Richtung des zerebralen Kortex ausbreiten. Trotz dieser klar erkennbaren Muster ist eine bemerkenswerte Diversität von klinischen Verläufen, zusätzlichen Symptomen sowie pathophysiologischen Prozessen und Risikofaktoren zu beobachten. Ähnlich wie bei der Alzheimer-Erkrankung und anderen dementiellen Syndromen wird vermutet, dass die Neurodegeneration sich entlang funktioneller Netzwerke ausbreitet. In den meisten Fällen geht die Parkinson-Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen einher. Besonders in den früheren Krankheitsphasen sind diese eher durch Dysfunktion auf Netzwerkebene als durch kortikale α-Synukleinablagerungen bedingt. Veränderungen im GBA-Gen stellen die wichtigsten genetischen Risikofaktoren für die Parkinson-Erkrankung dar. Sie erhöhen das Risiko für raschere motorische und kognitive Symptomprogression. Während Mutationen die lysosomale Speicherkrankheit Morbus Gaucher auslösen, sind die häufigeren Varianten p.E365K und p.T408M nur mit Parkinson assoziiert. Ihre pathologischen Effekte sind bislang unzureichend erforscht. In einem großangelegten Forschungsprojekt mit dem Ziel, pathophysiologische Prozesse weiter zu entschlüsseln und die Biomarkerentwicklung und Subtypisierung voranzubringen, wurden 62 Parkinson-PatientInnen und 25 KontrollprobandInnen ausführlich untersucht. Ein multimodales Neuroimagingprotokoll beinhaltete resting-state funktionelle Magnetresonanztomographie sowie Positronenemissionstomographie mit den Tracern [18F]fluorodeoxyglukose und 6-[18F]fluoro-L-Dopa. Daneben erfolgten, unter Anderem, genaue Untersuchungen von motorischen und kognitiven Funktionen, eine Gen-Panel Analyse und eine Gaschromatographie-Massenspektrometrie von Plasmametaboliten. Die Parkinson-Gruppe zeigte im Vergleich zu gesunden Kontrollen Glukose-hypometabolismus der laterokaudalen Substantia nigra und in temporo-okzipitalen kortikalen Regionen. Die Dopaminsynthesekapazität war mit Peaks im bilateralen posterioren Putamen reduziert und korrelierte mit ipsilateraler Aktivität im Bereich der Substantia nigra. Die Dopamin-depletierten Cluster dienten als Seeds in einer Analyse der resting-state funktionellen Konnektivität, wobei Hypokonnektivität mit dem senso-motorischen Netzwerk und Teilen des Default Mode Netzwerks aufgezeigt wurden. Die bilaterale inferiore parietale Region umgebend lagen Cluster, in denen die Hypokonnektivität positiv mit dem regionalen Glukosemetabolismus korrelierte, wobei diese Region keinen signifikanten Hypometabolismus im voxelbasierten Gruppenver-gleich zeigte. Die Ausprägung der motorischen Symptome und die Gesamtpunktzahl im Mini-Mental Status Test korrelierten mit Neuroimagingparametern. Diese Ergebnisse demonstrieren eine bislang unbekannte Reichweite der Zusammenhänge zwischen trimodalen Bildgebungsmarkern neuronaler Dysfunktion entlang der gesamten nigro-striato-kortikalen Achse und klinischen Merkmalen. Die Hypothese der Netzwerkdegeneration wird dadurch bestärkt. Eine später veröffentlichte Auswertung longitudinaler Daten in einer Subgruppe dieser Kohorte unterstützt diese Interpretation. In der genetischen Analyse wurden 13 Parkinson-PatientInnen als heterozygote Carrier von GBA-Varianten identifiziert (7 mit p.E365K, 6 mit p.T408M), 42 waren Non-carrier. Beide Gruppen waren demographisch und klinisch ähnlich. Carrier zeigten leicht aber signifikant reduzierte kognitive Leistung. Die Plasmaspiegel mehrerer Metabolite zeigten Gruppenunterschiede. Ein Parkinson-typisches Kovarianzmuster des zerebralen Glukosemetabolismus war im Zusammenhang mit GBA-Varianten stärker ausgeprägt, während die [18F]fluorodeoxyglukose-Aufnahme im medialen und lateralen parieto-okzipitalen Kortex signifikant reduziert war. Die Verteilung der Hypoaktivität ähnelte einem für Lewy-Körper Demenz typischen Muster. Als Hinweis auf einen weiter fortgeschrittenen Degenerationsprozess zeigten Variantencarrier geringere Dopamin-synthesekapazität in anterioren striatalen Regionen. Antikorrelationen der funktionellen Konnektivität zwischen Striatum und okzipitalem Kortex bei Carriern zeigten eine unerwartete Ähnlichkeit zu früheren Ergebnissen bei Parkinson-assoziierter Demenz als potenzielles Korrelat des erhöhten Risikos für kognitive Einschränkungen. Diese Neuroimagingmarker könnten beispielsweise als Endpunkte in klinischen Studien dienen, in denen die von GBA kodierte Glucocerebrosidase aktiviert wird. Die gemeinsame Betrachtung beider Studien erlaubt weitere Schlussfolgerungen: Es lag keine Überschneidung der Ergebnisse innerhalb der einzelnen Modalitäten vor. Manche Hirnregionen waren dennoch in beiden Studien relevant. Beispielsweise war im inferioren parietalen Kortex bei Parkinson-PatientInnen die Konnektivität mit dem Putamen reduziert und korrelierte mit der [18F]fluorodeoxyglukose-Aufnahme. Bei Variantencarriern zeigte sich dort Hypometabolismus. Unter der Annahme, dass Netzwerkdysfunktion eine Vorstufe zu Hypoaktivität darstellt, wäre dies ein Hinweis auf weiter fortgeschrittene Neztwerkdegeneration bei Carriern. Die hier aufgezeigten neuen Erkenntnisse über Zusammenhänge von multimodalen bildgebenden Markern der Hirnfunktion, Genetik und behavioralen Merkmalen vertiefen das pathophysiologische Verständnis der Parkinson-Erkrankung. Sie können dazu beitragen, Biomarker für klinische Studien und personalisierte Medizin zu entwickeln.
 Publikationsserver
Publikationsserver