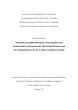Mortalität, gesundheitsbezogene Lebensqualität und Funktionalität nach proximaler Oberschenkelfraktur und ihre Einflussfaktoren in der 5-Jahres-Nachuntersuchung
Die proximale Femurfraktur ist durch eine hohe Inzidenz mit stetig steigenden Fallzahlen aufgrund des demographischen Wandels mit älter werdender Bevölkerungsstruktur gekennzeichnet. Neben einer hohen Mortalitätsrate geht die proximale Femurfraktur mit einer reduzierten gesundheitsbezogenen Lebensqu...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Die proximale Femurfraktur ist durch eine hohe Inzidenz mit stetig steigenden Fallzahlen aufgrund des demographischen Wandels mit älter werdender Bevölkerungsstruktur gekennzeichnet. Neben einer hohen Mortalitätsrate geht die proximale Femurfraktur mit einer reduzierten gesundheitsbezogenen Lebensqualität und Funktionalität einher. In die prospektiv angelegte Studie wurden 402 Patienten in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des UKGM Standort Marburg inkludiert. Das Durchschnittsalter des überwiegend weiblichen Patientenkollektivs lag zum Zeitpunkt der Rekrutierung bei 81 Jahren. Die zum Zeitpunkt der Aufnahme, der Entlassung, nach 6 Monaten und nach 12 Monaten durchgeführten Erhebungen wurden in der vorliegenden Arbeit durch eine 5-Jahres-Follow-up-Untersuchung ergänzt. Durch die gewonnenen Daten konnten die 5-Jahres-Mortalität sowie Langzeitergebnisse der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und Funktionalität nach proximaler Femurfraktur bestimmt werden.
Die 5-Jahres-Mortalität nach proximaler Femurfraktur liegt bei 62%. Unabhängige Risikofaktoren für eine erhöhte 5-Jahres-Mortalität sind höheres Lebensalter (p < 0,001), männliches Geschlecht (p = 0,002), kognitive Defizite bei Aufnahme (p = 0,002), eingeschränkte Funktionalität vor Frakturereignis (p = 0,024), vorbestehende Komorbiditäten (p = 0,033) und das Auftreten eines postoperativen Delirs (p = 0,008). Zur Reduktion der Mortalität nach proximaler Femurfraktur ist der Erhalt der Selbstständigkeit und Funktionalität der Patienten im höheren Lebensalter anzustreben. Während des stationären Aufenthaltes sollte ein postoperatives Delir bestmöglich verhindert werden oder schnellstmöglich diagnostiziert und therapiert werden. Eine entsprechende Schulung des Personals und interdisziplinäre Behandlung der vulnerablen Patientengruppe erscheint essentiell. Nach Möglichkeit sollte dem Akutaufenthalt eine Rehabilitation angeschlossen werden und das Entlassungsmanagement entsprechend frühzeitig initiiert und optimiert werden.
Die 5-Jahres-Nachuntersuchung wurde bei 134 der 152 überlebenden Patienten durchgeführt. Der weibliche Anteil des im Durchschnitt 83 Jahre alten Patientenkollektivs lag bei 81%.
Die Beurteilung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität erfolgte anhand des EQ5D- Index. Dieser war 5 Jahre nach proximaler Femurfraktur (0,66; CI 0,61-0,72) deutlich niedriger als die der über 65 Jahre alten deutschen Allgemeinbevölkerung (0,87; CI 0,86-0,89). Signifikant niedrigere HRQOL fand sich bei Pflegeheimbewohnern (bereits vor OP p = 0,037; nach 5 Jahren p < 0,001) sowie funktionell (Barthel-Index p = 0,001) und kognitiv (MMST p = 0,050) eingeschränkten, multimorbiden (ASA-Score p = 0,049; CCS p = 0,048) und älteren (p = 0,023) Patienten. Eine mögliche Depression (GDS p = 0,022) oder ein Delir (DRS p = 0,049) gingen ebenfalls mit einer niedrigeren HRQOL einher, während eine Totalendoprothese als OP-Verfahren eine positive Beeinflussung anzeigte (p = 0,048). Ein unabhängiger Einfluss auf den EQ5D-Index ergab sich in der bivariaten Regressionsanalyse für den Barthel-Index (p = 0,018). Der Erhalt der Funktionalität ist als elementar für eine langfristig bessere gesundheitsbezogene Lebensqualität einzustufen.
Die Funktionalität gemessen am Barthel-Index erreichte nach dem Tiefpunkt direkt postoperativ bereits nach 6 bis 12 Monaten wieder annähernd das präoperative Niveau und nahm im weiteren Verlauf wieder ab. Nach dem unmittelbar durch die Operation bedingten Abnahme der Funktionalität ist die Abnahme über den Langzeitverlauf durch das zunehmende Alter und mögliche begleitend auftretende Komorbiditäten bedingt. Das nach 6 Monaten festgestellte gute Potential zur Wiedererlangung der Funktionalität und Selbstständigkeit untermauert die Relevanz einer frühen postoperativen Mobilisierung sowie das Anschließen einer Rehabilitation. Ein signifikant schlechteres Outcome der Funktionalität konnte bei Pflegeheimbewohnern (p < 0,001) oder nach Entlassung in eine pflegerische Einrichtung (p < 0,001), höherem Patientenalter (p = 0,002), höherem ASA-Score (p = 0,001) und Charlson-Komorbiditäts-Index (p = 0,018), kognitiven Defiziten (p < 0,001), beim möglichen Vorliegen einer Depression (p = 0,029) oder eines Delirs (p = 0,002) sowie das Auftreten von Typ II Komplikationen (p < 0,001) festgestellt werden. Ein besserer Funktionsstatus zeigte sich nach TEP als OP-Verfahren (p = 0,012). In der multivariaten Analyse verblieben das Alter (p = 0,020), kognitive Defizite (p < 0,001), ein niedriger Barthel-Index vor Frakturereignis (p < 0,001) und das Auftreten von Typ II Komplikationen (p = 0,001) als unabhängige Einflussfaktoren. Kognitive Defizite sind generell mit einer eingeschränkten Funktionalität vergesellschaftet. Nach proximaler Femurfraktur gehen diese mit einem signifikant höheren Funktionsverlust einher, weshalb diesem Krankheitsbild zusätzliche Aufmerksamkeit zukommen sollte. Typ-II-Komplikationen sollten möglichst vermieden oder frühzeitig erkannt und behandelt werden um eine langfristige Einschränkung der Funktionalität zu vermeiden. |
|---|---|
| Umfang: | 140 Seiten |
| DOI: | 10.17192/z2023.0307 |
 Publikationsserver
Publikationsserver