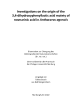Investigations on the origin of the 3,4-dihydroxyphenyllactic acid moiety of rosmarinic acid in Anthoceros agrestis
Plant terrestrialisation is closely linked to the evolution of phenolic secondary metabolites, which conferred a survival advantage in the presence of new environmental factors, e.g. UV-B radiation, drought, pathogens and herbivores. Besides the incorporation of phenolic components into structural e...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2022
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Die Terrestrialisierung der Pflanzen ist eng mit der Entwicklung phenolischer Sekundärmetabolite verbunden, die einen Überlebensvorteil gegenüber neuen Umweltfaktoren wie UV-B-Strahlung, Trockenheit, Krankheitserregern und Herbivoren verschaffen. Neben dem Einbau von phenolischen Komponenten in Strukturelemente (Cutikula, Sporenwand, Zellwand) sind Kaffeesäureester von Bedeutung. Rosmarinsäure, formal ein Ester aus Kaffeesäure und 3,4-Dihydroxyphenylmilchsäure, hat nachweislich unter anderem entzündungshemmende, antimikrobielle, antitumorale und antioxidative Wirkungen. Sie kommt nicht nur in Lamiaceae (Nepetoideae) und Boraginaceae vor, sondern ist im Pflanzenreich weit verbreitet, wobei Hornmoose, z.B. Anthoceros agrestis, die basalsten Vertreter sind. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die beiden Enzyme Tyrosin Aminotransferase (TAT) und Hydroxyphenylpyruvat Reduktase (H(P)PR) identifiziert, heterolog in E. coli exprimiert und enzymatisch charakterisiert. TAT wies eine Molekularmasse von etwa 50 kDa auf, wobei das aktive Enzym als Homodimer auftritt. Die höchste Enzymaktivität wurde bei einem pH-Wert von 7,9-8,4 bei 60 °C gemessen. Als wahrscheinlichstes Substrat/Co-Substrat-Paar wurde L-Tyrosin/2-Oxoglutarat ermittelt. Je nach den tatsächlichen Substratkonzentrationen könnte auch Phenylpyruvat in Betracht gezogen werden. Oxalacetat und Pyruvat hingegen wurden nur schlecht akzeptiert. Darüber hinaus wurden mehrere aromatische und aliphatische Aminosäuren sowie die Ketosäure Prephenat akzeptiert. Für die Identifizierung dieser Substrate wurde eine schnelle und zuverlässige Methode über Dünnschichtchromatographie mit Nachweis durch Ninhydrinfärbung, verifiziert durch HPLC und Derivatisierung mit o-Phthalaldehyd, eingeführt. Die HPPR hat eine Molekülmasse von etwa 35 kDa, auch dieses Enzym tritt aktiv als Homodimer auf. Die höchste Enzymaktivität wurde bei einem pH-Wert von 7,0-7,5 und einer Temperatur von 44 °C gemessen. Entgegen früheren Erwartungen wurde 4-Hydroxypyruvat als bestes Substrat mit NADPH als bevorzugtem Co-Substrat bestimmt und nicht 4-Hydroxyphenylpyruvat. Entsprechend der Enzymfamilie wurde bei der Reaktion nur das D-Enantiomer von 4-Hydroxyphenyllactat gebildet. Die Ergebnisse stimmen weitgehend mit Beobachtungen an heterolog exprimierter H(P)PR aus Coleus blumei überein. Darüber hinaus wurden das 3-hydroxylierte und methoxylierte Derivat von 4-Hydroxyphenylpyruvat sowie Phenylpyruvat und Pyruvat akzeptiert. Während für TAT in Anthoceros agrestis keine weiteren Isoformen gefunden werden konnten, ließen sich HPPR2 sowie das verwandte HPR1, das photorespiratorische Isoenzym, amplifizieren und heterolog in E. coli exprimieren. HPPR2 zeigte eine vergleichbare Aktivität mit Hydroxypyruvat und 4-Hydroxyphenylpyruvat, während HPR1 letzteres nicht akzeptierte und NADH bevorzugte. Die untersuchten Enzyme TAT, HPPR sowie HPPR2 könnten aufgrund ihrer enzymatischen Eigenschaften an der Biosynthese der 3,4-Dihydroxyphenylmilchsäureeinheit analog zu Coleus blumei beteiligt sein. Die Expressionsanalyse über eine 14-tägige Kulturperiode zeigte einen parallelen Verlauf der TAT- und HPPR2-Transkriptabundanz und des Rosmarinsäuregehalts, der sich von einer früheren Beobachtung bei anderen Suspensionskulturen von Anthoceros agrestis unterschied. Eine eindeutige Aussage über die Beteiligung der genannten Enzyme kann auf Grundlage dieser Daten nicht getroffen werden. Die Identifizierung der potenziellen Schlüsselenzyme hat jedoch eine solide Grundlage für künftige Arbeiten geschaffen, die sich auf in-vivo-Analysen konzentrieren sollten.
 Publikationsserver
Publikationsserver