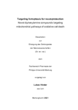Targeting ferroptosis for neuroprotection: Novel diphenylamine compounds targeting mitochondrial pathways of oxidative cell death
Neurodegenerative disorders such as Alzheimer’s and Parkinson’s disease as well as stroke are of growing concern in our aging societies. In the last decades, biochemical hallmarks of these pathologies, containing excessive lipid peroxide formation, iron overload and mitochondrial impairments were li...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2021
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Neurodegenerative Erkrankungen wie die Alzheimer- und Parkinson-Krankheit als auch der Schlaganfall sind von zunehmender Bedeutung in unserer alternden Gesellschaft. In den vergangenen Jahren wurden bei diesen Erkrankungsbildern biochemische Merkmale, wie eine übermäßige Lipidperoxidbildung, Eisenüberladung und eine Schädigung der Mitochondrien festgestellt. Diese Merkmale sind eng mit den kürzlich beschriebenen Formen des regulierten, oxidativen Zelltods verknüpft, die als Oxytose und Ferroptose bezeichnet werden. Für Neurone ist eine Schädigung der Mitochondrien besonders problematisch, da diese infolge ihrer elektrischen Aktivität einen sehr hohen Energiebedarf aufweisen. Daher stellen Ansätze, die auf den Schutz der Mitochondrien abzielen, eine sinnvolle Möglichkeit dar, neuronale Zellen vor dem Untergang zu schützen. Insbesondere das pro-apoptotische Protein BID ist dabei von zentraler Bedeutung. In vitro und in vivo Studien belegen eine enge Verbindung zwischen dem BID Protein und neuronalem Zelltod, der unter anderem durch Oxytose und Ferroptose hervorgerufen sein kann. Daher ist das BID Protein ein interessantes Zielmolekül, um z.B. Ferroptose-Inhibitoren zu entwickeln, die anschließend gegebenenfalls als Wirkstoffe zur Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen eingesetzt werden könnten. Die computergestützte in silico Suche nach neuen Wirkstoffkandidaten war jedoch bislang nur eingeschränkt möglich, da hochaufgelöste 3D-Röntgenstrukturdaten des BID-Proteins fehlten. Daher sollte in der vorliegenden Arbeit die Kristallstruktur des BID-Proteins aufgeklärt werden. Für diese Experimente wurde das bereits etablierte Bid3CCSS-Konstrukt genutzt. Im Rahmen früherer Arbeiten durchgeführte Hochdurchsatz-Screens zeigten, dass in der Morpheus A5-Bedingungen zuverlässig Bid3CCSS Kristalle erhalten wurden, die allerdings starke Verwachsungen aufwiesen. Durch eine akribische, strukturierte Testung aller Bestandteile der Ausgangsbedingung, mit anschließendem Seeding und Kryo-Schutz konnte die Kristallqualität erheblich verbessert werden. Die durch dieses Vorgehen erhaltenen stäbchenförmigen Kristalle wurden anschließend röntgenkristallographisch untersucht. Dabei wurden für die apo Bid3CCSS-Kristalle Datensätze mit einer Auflösung von 2,0-2,3 Å erhalten. Nach erfolgreicher Phasenbestimmung, mit Gadolinium-Acetat-getränkten Bid3CCSS Kristallen, konnte nun erstmalig eine Kristallstruktur des Bid3CCSS Proteins erstellt werden. Bid3CCSS kristallisierte dabei als Trimer. Obwohl das Protein hauptsächlich aus Alpha-Helices aufgebaut ist, lagen größere Bereiche von zwei der drei Monomere weitgehend ungeordnet vor, was zu einer unterdurchschnittlichen Verfeinerungsstatistik führte. Allerdings wies die Kristallstruktur eines Monomers eine definierte Elektronendichte für die gesamte Aminosäurenkette auf, sodass dieses für zukünftige in silico-Versuche zur Ligandenfindung herangezogen werden kann. Es wird dennoch empfohlen weiterführende kristallographische Experimente durchzuführen, um die Flexibilität des Proteins im Kristallverband zu verringern, die Kristallpackung durch eine Optimierung der Kristallkontakte zu ändern und mit Hilfe verschiedener Ligandenfragmente neue Bindungstaschen zu identifizieren. Im zweiten Teil der Arbeit wurden neuartige Diphenylaminverbindungen (DPA) in Modellsystemen der Ferroptose charakterisiert. Diese Verbindungen wurden zuvor mittels medizinisch-chemischer Methoden entwickelt, um neuartige Inhibitoren gegen den oxidativen Zelltod zu identifizieren. Der bekannte BID-Inhibitor BI-6c9 diente dabei als Matrize. In der vorliegenden Studie zeigte sich, dass diese DPA-Verbindungen sehr potente und selektive Ferroptose-Inhibitoren darstellten. Mit EC50-Werten zwischen 0,23-0,32 µM waren die neuen Verbindungen um das 10-20-fache protektiver gegen den oxidativen Zelltod als alle bislang beschriebenen BID-Inhibitoren. Die DPA-Verbindungen waren dabei in der Lage die Bildung von Lipid-ROS, sowie zytosolische und mitochondriale ROS Entstehung zu unterdrücken. Diese Hemmung erfolgte ohne eine Beeinflussung der Glutathionspiegel und der GPX4-Expression, welche wesentliche Bestandteile des antioxidativen Systems der Zelle darstellen. Ausgeprägte Radikalfänger-Eigenschaften der DPA-Verbindungen konnten ebenfalls nicht festgestellt werden. Dahingegen wurde die mitochondriale Integrität durch die Verbindungen konzentrationsabhängig bewahrt. Nachbehandlungsexperimente untermauerten schließlich die Annahme, dass eine durch die DPA-Verbindungen vermittelte Mitochondrienprotektion sowie eine Störung der ROS-Bildungsprozesse zum Schutzmechanismus beitragen. Untersuchungen der Verbindungen mittels t-BID-Toxizitätsexperimenten, NMR- und MST-Methoden sowie Co-Kristallisations- und Soaking-Experimenten, konnten bis dato keine eindeutige Interaktion der neuen Verbindungen mit dem BID/ t-BID Protein bestätigen oder entsprechende Bindungsstellen definieren. Um diese Fragestellung allerdings abschließend klären zu können, bedürfen die genannten Testverfahren weiterer Optimierung. Zusammenfassend unterstreicht diese Arbeit den mitochondrialen Schutz als mögliche Strategie für die Entwicklung weiterer Ferroptose-Inhibitoren, welche als zukünftige Behandlungsoptionen von neurodegenerativen Erkrankungen eingesetzt werden könnten. Die in vitro-Ergebnisse sprechen dafür, die DPA-Verbindungen weiter in vivo zu untersuchen, um weitere Erkenntnisse zur Toxizität und Wirksamkeit in Modellen zu gewinnen, in denen Ferroptose eine wichtige Rolle spielen könnte. Dafür würden sich z.B. Modelle des hämorrhagischen Schlaganfalls eignen.
 Publikationsserver
Publikationsserver