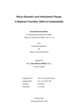Micro-Dynamics and Institutional Change in Regional Transition Paths to Sustainability
Major ecological and social challenges require fundamental societal changes towards more sustainable production and consumption patterns. An important basis for such "sustainability transitions" are changes in institutional structures (e.g., laws, values and interpretive schemes) that pr...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2019
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Angesichts ökologischer und sozialer Herausforderungen sind grundlegende gesellschaftliche Veränderungsprozesse hin zu nachhaltigeren Produktions- und Konsummustern erforderlich. Eine wichtige Grundlage für solche „Nachhaltigkeitstransitionen“ sind Veränderungen in institutionellen Strukturen (z.B. Gesetzen, Wertvorstellungen und Deutungsschemata), die nachhaltige soziale Praktiken fördern. Allerdings weiß man zurzeit noch wenig darüber, wie solche institutionellen Veränderungen angestoßen werden und wie sie sich entwickeln. So ist kaum bekannt, wie sich die Aktivitäten von Akteuren auf der Mikro-Ebene langfristig auf die Entwicklung institutioneller Strukturen auswirken und warum solche Prozesse zwischen einzelnen Regionen unterschiedlich ablaufen. Die vorliegende Arbeit untersucht solche institutionellen Veränderungsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit aus einer regionalen Perspektive, um zu verstehen, wie sich Nachhaltigkeitstransitionen regionsspezifisch entwickeln. Ausgehend von der Prämisse, dass sich regionale Nachhaltigkeitstransitionen von sektoralen Transitionen unterscheiden, die bislang im Fokus der Transitionsforschung standen, verfolgt die Arbeit drei Ziele: (1) die Entwicklung eines konzeptionellen Ansatzes, der die Besonderheiten von institutionellem Wandel in regionalen Nachhaltigkeitstransitionen erfasst; (2) die Entwicklung eines methodologischen Ansatzes, der es ermöglicht die komplexen institutionellen Dynamiken regionaler Nachhaltigkeitstransitionen zu analysieren; (3) empirische Erkenntnisse über regionale Nachhaltigkeitstransitionen und die Akteure zu generieren, die diese Prozesse auf der Mikro-Ebene vorantreiben. Der neu entwickelte konzeptionelle Ansatz der „Regionalen Transitionspfade zur Nachhaltigkeit“ (RTPS) verbindet Erkenntnisse aus der Transitionsforschung, der Neo-institutionellen Theorie und der Evolutionären Wirtschaftsgeographie (EEG). Anders als existierende Konzepte aus der Transitionsforschung (insbesondere die Multi-Level Perspektive; MLP) berücksichtigt der RTPS-Ansatz die Besonderheiten regionaler Nachhaltigkeitstransitionen, beispielsweise ihren graduellen und regimeübergreifenden Charakter, die räumliche Nähe von Akteuren, regionale Pfadabhängigkeiten und die Einbettung von Regionen in multi-skalare Governance-Strukturen. Der Ansatz fokussiert auf die Rolle neuer Organisationsformen als „Wegbereiter“ von Wandel und Stabilität in regionalen Transitionspfaden zur Nachhaltigkeit. Dadurch trägt er zu einem besseren Verständnis gradueller Veränderungen in regionalen institutionellen Strukturen und den ihnen zugrundeliegenden Mikro- Dynamiken bei. Aufbauend auf dieser theoretischen Grundlage wird der methodische Ansatz der „Transitionstopologie“ entworfen. Dieses Instrument ermöglicht es, institutionelle und organisatorische Veränderungsprozesse in ihrem spezifischen Raum-Zeit-Kontext zu visualisieren und zu rekonstruieren. Die Topologie veranschaulicht somit, wie institutioneller Wandel mit organisatorischen Veränderungen innerhalb einer Region verbunden ist. Auf diese Weise lässt sich darstellen, wie Prozesse auf der Mikro-Ebene graduelle Veränderungen im regionalen Pfad auslösen, die über die Zeit zu einem fundamentaleren Wandel auf der Makro-Ebene führen können. Die Transitionstopologie ermöglicht es, Transitionspfade zur Nachhaltigkeit in verschiedenen Regionen systematisch zu analysieren und zu vergleichen. | ii Unter Anwendung dieser neu entwickelten konzeptionellen und methodischen Ansätze werden drei empirische Fallstudien durchgeführt: a) eine detaillierte Studie über die Mikro-Dynamiken von regionalen Nachhaltigkeitstransitionen in Augsburg (Deutschland), b) ein Vergleich der Einbindung von Universitäten in regionale Nachhaltigkeitstransitionen in Augsburg und Linz (Österreich) und c) eine Analyse der Rolle von Hochschulen in regionalen Nachhaltigkeitstransitionen in Oberösterreich. Ergänzt werden diese Studien durch eine auf einem mixed-methods-Design basierende Analyse der Motive von Forschern für die Wahl eines nachhaltigkeitsbezogenen Forschungsthemas. Die Untersuchungen machen Prozesse und Dynamiken sichtbar, welche die Diversität von Transitionspfaden im Raum (z.B. deren unterschiedliches Tempo, ihre thematische Breite) erklären und bislang in der Transitionsforschung weitgehend verdeckt geblieben sind. Sie heben die Bedeutung von wertgetriebenen Individuen in regionalen Nachhaltigkeitstransitionen hervor, die oftmals gleichzeitig in verschiedenen thematischen Bereichen aktiv sind und dadurch Synergien herstellen. Vor allem wird die Relevanz unterschiedlicher Organisationsformen für institutionellen Wandel in regionalen Nachhaltigkeitstransitionen deutlich. Während temporäre Organisationsformen die Entwicklung nachhaltiger sozialer Praktiken unterstützen, sind langfristig angelegte Organisationen wichtig, um diese neu entwickelten Praktiken zu stabilisieren. Die vorliegende Arbeit leistet originäre Beiträge zur geographischen Transitionsforschung sowohl auf konzeptioneller, als auch auf methodologischer und empirischer Ebene. Sie ermöglicht ein besseres Verständnis der institutionellen Dynamiken regionaler Nachhaltigkeitstransitionen und schafft somit eine wichtige Grundlage für die Förderung solcher Prozesse in der Praxis.
 Publikationsserver
Publikationsserver