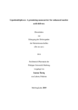Lipodendriplexes: A promising nanocarrier for enhanced nucleic acid delivery
The main objective of the current study was to developed an optimized system for enhanced nucleic acid delivery with minimum cytotoxicity. For efficient therapeutic gene delivery, PAMAM dendrimer, with ethylenediamine core was chosen due to its biodegradable and non-immunogenic nature. However, the...
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Այլ հեղինակներ: | |
| Ձևաչափ: | Dissertation |
| Լեզու: | անգլերեն |
| Հրապարակվել է: |
Philipps-Universität Marburg
2019
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | PDF ամբողջական տեքստ |
| Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
Das Hauptziel der aktuellen Studie war die Entwicklung eines optimierten Gentransfersystems mit minimaler Zytotoxizität und maximaler Effizienz. Für einen effizienten Gentransfer dienten PAMAM-Dendrimere, die aus einem Ethylendiamin-Kern bestehen und biologisch abbaubar und wenig immunogen sind. Die Zytotoxizität und die ungewöhnliche Verteilung in biologischen Systemen erforderten jedoch eine Schutzabschirmung dieser polykationischen Polymersysteme. Die Ausnutzung von nichtkovalenten Wechselwirkungen von Dendriplexen mit Lipiden wurde als ein nützliches technologisches Instrument genutzt, um diese Nachteile zu überwinden. Der methodische Teil der Arbeit beschreibt die Herstellung von Liposomen, Dendriplexen, Lipodendriplexen und deren anschließende physikalisch-chemische Charakterisierung bis hin zu in-vitro-, in-ovo- bzw. in-vivo-Studien. Der Ergebnisabschnitt der Arbeit umfasst die Charakterisierung von Dendriplexen, welche die Voraussetzung für die Bildung von Lipodendriplexen darstellen. Die Überprüfung der Integrität der Bildung stabiler Dendriplexen wurde mit Hilfe der Gel-Retardations Chromatographie und des Fluoreszenzlöschungsassays durchgeführt. Dynamische Lichtstreuung und Laser-Doppler-Anemometrie bestätigten ebenfalls die stabile Komplexbildung in einem gewünschten Größenbereich (von unter 200 nm), der für eine optimale zelluläre Aufnahme geeignet ist. Auf Grund der höchsten pDNA-Transfektionseffizienz und einer geringen Zelltoxizität wurde ein N/P-Verhältnis von 12 für die Liposomenkomplexierung verwendet. Ein breites Spektrum liposomaler Formulierungen wurde zur Komplexierung mit Dendriplexen untersucht und der Einfluss des Liposom-PAMAM-Verhältnisses auf die Oberflächenladung und die Größe von Lipodendriplexen wurde detailliert beschrieben. Die Untersuchung der Oberflächenmorphologie der Liposomen und Lipodendriplexe fand mit Hilfe der Rasterkraftmikroskopie statt. Die gemessenen Durchmesser wurden mit den Ergebnissen der dynamischen Lichtstreuung verglichen. Eine breite Vielfalt an verschiedenen Lipodendriplex-Formulierungen sind hergestellt, charakterisiert und deren Transfektionsstudien diskutiert worden. Die DPPC:CH-PAMAM-Lipodendriplexe zeigten eine signifikante Verbesserung der pDNA-Transfektion im Vergleich zu anderen Lipodendriplex Formulierungen und Dendriplexen. Eine GFP-Expressionsanalyse bestätigte die erhöhte Genexpression. Untersuchungen zur Zytotoxizität, einschließlich MTT-, ROS-, Lysosomal-Disruptions und DNA-Schädigungs Assays, wurden ausführlich diskutiert. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass die Lipidmodifikation, die für Zelltoxizität verantwortlichen terminalen Aminogruppen von Dendriplexen abschirmen und letztendlich zu einer erhöhten Zellüberlebensrate führen. Das Biokompatibilitätsprofil wurde untersucht, um die Verträglichkeit der Komplexe in Blutbestandteilen zu überprüfen. Der Heparin-Kompetitions- und Hämolysetest bestätigte die deutlich verbesserte Biokompatibilität von Lipodendriplexen im Vergleich zu den Dendriplexen. Ein weiteres Ziel der Arbeit bestand darin, den siRNA Gen-Silencing-Effekt zu untersuchen. Im Vergleich zu Dendriplexen und zu der siRNA-Kontrollgruppe zeigten Lipodendriplexe eine ausgeprägte Herunterregulierung des Luciferase-, GFP- und des therapeutisch relevanten MDR1-Gens. Die Rolle von MDR1 bei der Zellmigration und Kolonisierung von Krebszellen wurde ebenfalls ausführlich beschrieben. Die Herunterregulierung des MDR1 Gens durch Lipodendriplexe zeigte eine signifikante Hemmung des Tumormetastasenwachstums und deren Abwanderung/Weiterverbreitung. Die Untersuchung des Knockdown-Effekts des MDR1-Gens erfolgte in einer 3D-Zellkulturumgebung, die eine ähnliche Situation wie in-vivo simuliert. Die Zellmigrations- und Ringschluss-Assays wurden unter Verwendung eines 3D-Tumor-Sphäroid- und Ring-Bioprinting-Modells durchgeführt. Eine deutliche Hemmung der Zellmigration wurde dabei festgestellt. Der nächste Schritt bestand in der Untersuchung der verstärkten intrazellulären Akkumulation des Tyrosinkinaseinhibitors (Imatinib-Mesylat) nach der Herunterregulierung von P-gp, das vornehmlich für die zelluläre Arzneimittelausschleusung verantwortlich ist, und der anschließenden Apoptose beim Kolonkarzinom. Der Apoptosetest wurde in 2D- und 3D-Kulturen unter Verwendung von Durchflusszytometrie bzw. Lebendtotfärbung durchgeführt. Die Ergebnisse der 2D-Kultur haben eine Bestätigung der in 3D-Zellkulturen erhaltenen Daten erbracht. Aus den Befunden knonnte geschlossen werden, dass nach der wirksamen Herunterregulierung von P-gp durch Lipodendriplexe die intrazelluläre Akkumulation des Wirkstoffs und anschließend die zelluläre Apoptose erhöht wurde. Die Zellzyklusanalyse bestätigte auch die durch Imatinib-Mesylat induzierte Apoptose, die durch einen Stillstand der Sub-G1-Phase angezeigt wird und eine wirksame Herunterregulierung von P-gp durch Lipodendriplexe darstellt. Um die Verwendung von Tieren in vorklinischen Experimenten zu verringern, ist eine Alternative, das sogenannte in-ovo chorio allantois Membranmodell verwendet worden, um die Exposition von Komplexen in-vivo-ähnlicher Umgebung zu untersuchen. Es wurde beobachtet, dass die Lipodendriplexe eine erfolgreiche GFP-Expression auf der CAM-Oberfläche und kein toxisches Verhalten in den CAM-Gefäßen aufwiesen. Danach konnten die Komplexe nach Festlegung des verbesserten Gentransfektions- und Toxizitätsprofils unter in-vitro-Bedingungen, in-vivo-Bioverteilung und Toxizitätsbewertung geplant und ausführlich erörtert werden. Die in-vivo-Bioverteilung zeigte, dass die Verkapselung von Dendriplexen in Liposomen die zelluläre Aufnahme der Komplexe wesentlich erhöht hat, was durch ex-vivo-Bildgebung der präparierten Organe bestätigt wurde. Studien zur akuten Toxizität wurden ebenfalls eingehend untersucht. Es konnte beobachtet werden, dass die mit Lipodendriplexen behandelte Gruppe keine Änderung des Körpergewichts, des Verhältnisses von Organ zu Körper und der Histopathologie des Organgewebes hervorrief. Serumbiomarker und hämatologische Studien zeigten auch die Biokompatibilität in einer in-vivo-Umgebung. Die Ergebnisse zeigen, dass die Entwicklung eines solchen nicht-viralen Genvehikels für eine effiziente Gentransfektion mit einem besseren Sicherheitsprofil sowohl in-vitro als auch in-vivo verwendbar wird. Weitere in-vivo-Studien mit verschiedenen präklinischen Modellen zur gezielten Therapie von verschiedenen Arten von Tumoren und genetischen Störungen könnte das therapeutische Potential diesen neuartigen Lipodendriplexen bestätigen.
 Publikationsserver
Publikationsserver