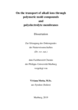On the transport of alkali ions through polymeric mold compounds and polyelectrolyte membranes.
The aim of this work is the attempt in understanding ion transport properties across structured materials such as polyelectrolyte multilayers (PEMs) and highly filled epoxy resins used as an encapsulant, i.e. mold compounds. The ion transport properties are studied by means of the technique of charg...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2019
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Ionentransporteigenschaften über strukturierte Materialien wie Polyelektrolyt Multilagen (PEMs) und sogenannte „Mold compounds“, die als Vergussmasse zum Beispiel für Computerchips verwendet werden, zu verstehen. Die Ionentransporteigenschaften werden mit Hilfe des kürzlich entwickelten „charge attachment induced transport“ (CAIT), einer Methode bei der Ladungsträgertransport durch Anlagerung von geladenen Teilchen auf der Probenoberfläche induziert wird, und der Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektrometrie (ToF-SIMS) untersucht. Im Rahmen dieser Arbeit wurden vier unterschiedliche Typen von „mold compounds“ untersucht, die sich in Ihrer Zusammensetzung unterschieden. Dabei wurde der Anteil des Kieselsäure-Füllstoff sowie der Anteil der Epoxidharz, Härter und Flammschutzmittel variiert. Die Proben werden mit Hilfe der CAIT-Technik analysiert. Dabei erhält man Werte für die Ionenleitfähigkeit und die Aktivierungsenergie im Zusammenhang mit dem Transport von Kaliumionen. Die Ionenleitfähigkeit der „mold compounds“ liegt in der Größenordnung von 10-12 / 10-13 S/cm, während die Aktivierungsenergiewerte in einem Bereich von 1.3 eV bis 2.7 eV liegen. Zum besseren Verständnis des Kaliumdiffusionsprozesses in den „mold compounds“ wird die Diffusion von Kalium mit einer Kombination der CAIT-Methode und einer Ex-situ-ToF-SIMS-Analyse untersucht. Die ToF-SIMS-Analyse zeigt ein Diffusionstiefenprofil des Kaliums in der Probe. Es wird eine mathematische Theorie auf Basis der Nernst-Planck-Poisson Gleichungen genutzt, um die Diffusionskoeffizienten für den Transport von Kalium zu bestimmen. Eine gute Übereinstimmung zwischen experimentellen und theoretischen Profile erreicht man unter der Annahme, dass zwei unabhängige Transportwege vorhanden sind. Man kann die Diffusion durch das Volumen des Materials sowie die Diffusion entlang von Korngrenzen unterscheiden. Diffusionskoeffizienten von DB = 1.8 × 10-21 cm2s-1 und DBG = 5.4 × 10-20 cm2s-1 werden für die Volumen- bzw. Korngrenzendiffusion gefunden. Die in dieser Arbeit untersuchten PEM-Filme werden Schicht für Schicht aus ionischem p-Sulfonato-Calix[8]arene (Calix8) und kationischem Poly(allylaminhydrochlorid) (PAH) auf funktionalisierten Goldsubstraten hergestellt. Proben mit n = 1, 3, 6, 9, 12, 15, 20, 30 Doppelschichten werden mittels der CAIT-Technik analysiert. Die durchgeführten Strommessungen zeigen, dass Leitfähigkeits- und Aktivierungsenergiemessungen für (PAH / calix8)n unter den Randbedingungen der CAIT-Methode aufgrund des niedrigen spezifischen Widerstands nicht erfasst werden können. Die erreichbaren Ionenstromstärken reichen nicht aus, um die Oberfläche auf das Quellpotential aufzuladen. Daher wurde eine Probe mit 30 Doppelschichten zunächst mit Hilfe von CAIT mit einem Alkaliionenstrahl beschienen und nachfolgend mit ToF-SIMS untersucht. Aus dem so entstandenen Tiefenprofil erhofft man sich Aussagen über den Diffusionskoeffizienten ableiten zu können. Das Experiment wurde mit drei unterschiedlichen Alkaliionenstrahlen durchgeführt: Li+, K+, Rb+. Mit jedem der Ionenstrahlen wurde zunächst eine Probe für 5 s beschienen. In einer zweiten Sequenz von Experimenten wurden die Proben für 100 s mit dem Ionenstrahl beschienen. Die Auswertung der Konzentrationsprofile liefert qualitative Informationen über die Transporteigenschaften, während die numerische Analyse der Lithium- und Rubidium-Konzentrationsprofile für einen 5 Sekunden langen Beschuss quantitative Informationen über den Diffusionsprozess liefert. Die numerische Berechnung zeigt, dass der Lithium- und Rubidiumtransport durch Transport auf zwei unterschiedlichen Wegen stattfindet. So konnten schnelle und langsame Ionen unterschieden werden, die dezidiert unterschiedliche Diffusionskoeffizienten aufwiesen. Für den Transport von Lithium wird eine gute Übereinstimmung zwischen experimentellen und theoretischen Profilen unter Verwendung von Diffusionskoeffizienten Dslow, Li+ = 0.4 × 10–16 cm2/s und Dfast,Li+ = 1.2 × 10–15 cm2/s erreicht. Man musste dazu annehmen, dass 40% der eintretenden Ionen den langsamen Pfad durch die Probe nehmen, während der Rest der Ionen über einen schnellen Weg transportiert wird. Für den Rubidium Trasnport zeigt die numerische Berechnung, dass der schnelle Diffusionsweg vorherrscht: Nur 0.01% der Rubidiumionen treten in den langsamen Weg ein, während der Rest den schnelleren Pfad nimmt wird, mit einem Dfast, Rb+ = 7 x 10-15 (± 1.5 × 10-15) cm2/s. Die Untersuchung des Ionentransports der Alkaliionen Li+ und Rb+ durch PEMs auf Calixarene-Basis führt daher zu dem Schluss, dass die Anwesenheit der Calixarene-Einheiten die Art des Transports beeinflussen kann. Zuletzt werden Studien zum Spannungsversatz an Strom-Spannungs-Kurven in einem typischen CAIT-Experiment vorgestellt. Diese Studie hatte das Ziel, die Neutralisations- und Kontaktprozesse an den Grenzflächen zu verstehen. Dazu wird ein grundlegendes CAIT-Experiment durchgeführt, bei dem eine Metallplatte mit einem Ionenstrahl aus einem Kaliumemitter der Zusammensetzung KAlSi2O6: Mo (1:9) beschossen wird. Die erfassten Strom-Spannungs-Kurven zeigen endliche Offsets in der Größenordnung von 0.5 eV. Um den Detektionsprozess des spezifischen Emitters KAlSi2O6: Mo (1: 9) zu untersuchen, werden Werte der ionischen und elektronischen Austrittsarbeit ausgewertet. Anhand eines theoretischen Modells wird die Rekombination von K+-Ionen aus Leucite KAlSi2O6: Mo (1: 9) auf dem Metalldetektor auf eine Kombination der ionischen und elektronischen Austrittsarbeit des Emittermaterials und zurückgeführt die Rekombinationsenergie des elementaren Kaliums I.E.K.
 Publikationsserver
Publikationsserver