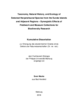Taxonomy, Natural History, and Ecology of Selected Herpetofaunal Species from the Sunda Islands and Adjacent Regions – Synergistic Effects of Fieldwork and Museum Collections for Biodiversity Research
In this cumulative thesis (papers 1–13) I investigated the taxonomy, natural history, and ecology of selected species of amphibians and reptiles from the Sunda Islands and adjacent regions, and highlighted the importance of natural history collections for biodiversity research. Several Sundaic speci...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2018
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Im Rahmen der vorliegenden kumulativen Dissertation (Publikationen 1–13) stelle ich Studien zur Taxonomie, Naturgeschichte und Ökologie ausgewählter und überwiegend problematischer Amphibien- und Reptiliengruppen der Sunda Inseln und angrenzender Gebiete vor, wobei auf die Synergieeffekte zwischen Freilandarbeit und sammlungsbasierter Forschung und auf den damit erzielten Mehrwert der Forschung für die Biodiversitätsforschung eingegangen wird. Die Bearbeitung der Herpetofauna in allen Distrikten von Timor-Leste (mit Ausnahme der Exklave Oecusse), inklusive der vorgelagerten Inseln, stellte einen konstruktiven Beitrag zur Arterfassung der Amphibien und Reptilien eines Landes dar, das an der südlichen Grenze des Wallacea-Hotspots liegt. Neue Verbreitungsnachweise für die Herpetofauna aus 11 der 12 aneinandergrenzenden Distrikte wurden, zusammen mit naturgeschichtlichen Daten, präsentiert. Als Ergebnis dieses Arteninventars stieg die Anzahl der ursprünglich aus Timor-Leste bekannten Amphibien und Reptilien auf über 60 Taxa, darunter mehr als 20 Kandidaten-Arten. Viele der nachgewiesenen Arten scheinen auf Timor endemisch zu sein. Zu diesen gehören der Ochsenfrosch Kaloula sp. nov., mehrere Bogenfingergeckos der Gattung Cyrtodactylus und die Agame Draco timoriensis. Zu den bemerkenswerten Entdeckungen unter den Reptilien zählen sowohl mindestens sieben unbeschriebene Arten von Cyrtodactylus, einer Gattung, die bislang nicht auf Timor nachgewiesen wurde, als auch die Erstnachweise der Gecko-Art Hemidactylus garnotii und der Gecko-Gattung Hemiphyllodactylus für Timor-Leste sowie zahlreiche unbeschriebene Skinke (Kapitel 4, Publikationen 1 & 2). Revisionen der Gattung Cyrtodactylus und der Skink-Gattungen Eremiascincus auf Timor und benachbarten Inseln, sowie die Beschreibung bisher unbekannter Arten, zusammen mit Kollegen aus den USA und Großbritannien, sind gegenwärtig in Vorbereitung. Eine auf Timor beschränkte Revision der Gattung Cyrtodactylus war nicht möglich, ohne vorab die verworrene Taxonomie einiger Arten, die außerhalb von Timor vorkommen, zu klären. Die Taxonomie dieser in angrenzenden Gebieten vorkommenden Cyrtodactylus-Arten wurde in drei Publikationen näher untersucht (Kapitel 5, Publikationen 3–5). Eine neue Cyrtodactylus-Art, die in der herpetologischen Sammlung des Senckenberg Naturmuseums Frankfurt, Deutschland, ursprünglich als C. fumosus katalogisiert worden war, wurde beschrieben; sie stammt aus Klakah, Lumajang, Ostjava, Indonesien. Die neue Art unterscheidet sich von allen Vertretern der Gattung durch eine Kombination von sieben Merkmalen (Publikation 3). Die Diversität der Cyrtodactylus-Fauna von Java wurde, ähnlich derer auf Timor, lange Zeit unterschätzt, und erst in diesem Jahrtausend wurden vier der fünf auf dieser Insel endemischen Arten beschrieben. Cyrtodactylus fumosus, eine Art, die bisher im südostasiatischen Archipel – mit Nachweisen aus Sumatra, Java, Bali, Sulawesi und Halmahera – als weitverbreitet galt, wurde neu definiert. Es konnte bestätigt werden, dass Männchen dieser Art eine präkloakale Furche aufweisen. Die Untersuchung des Holotypus und weiteren Belegmaterials aus Rurukan und vom Mount Masarang (Nord Sulawesi, Indonesien) ergab, dass diese Population von anderen Formen, die bisher als „fumosus“ bezeichnet wurden, durch eine Kombination einzigartiger Merkmale unterscheidbar ist. Cyrtodactylus fumosus konnte auf Grund seiner Merkmale als die auffallendste Art der sechs auf Sulawesi vorkommenden Bogenfingergeckos identifiziert werden (Publikation 5). Weil bislang große taxonomische Verwirrung zwischen C. fumosus und C. marmoratus herrschte, wurde die Typusserie des letzteren Taxons zum ersten Mal komplett beschrieben. Ich konnte zeigen, dass die Typusserie historisch bedingt in zwei Gruppen (mit unterschiedlichen, aber ähnlichen Seriennummern) aufgeteilt wurde, und dass die Untersuchung von Exemplaren aus nur jeweils einer der beiden Gruppen für Wirren um diese Belege verantwortlich war. Aufgrund der inkonsistenten Terminologie und Anwendung von Begriffen für Schlüsselmerkmale, die bei der Diagnose von Bogenfinger-Geckos Verwendung finden (z.B. Furche, Sulcus, Grube, Mulde, Vertiefung), wurde eine Reihe neuer und nützlicher Definitionen vorgeschlagen. Eine Vergleichstabelle für die Bogenfinger-Geckos der Sunda Inseln und Sulawesis wurde zum ersten Mal bereitgestellt (Publikation 4). Die Cyrtodactylus-Fauna der Kleinen Sundainseln, der Molukken und Sulawesis soll künftig weiter untersucht werden. Zahlreiche Museumsexemplare werden als Basis für die Beschreibung neuer Arten dienen. Die Entdeckung einer Walzenschlange der Gattung Cylindrophis in Timor-Leste führte zu einer umfassenden Untersuchung des im maritimen Südostasien weit verbreiteten Taxons C. ruffus. Eine neue Art, die in den Sammlungen des Naturalis Biodiversity Centers, Leiden, Niederlande, und der Naturhistorischen Museums Wien, Österreich, ursprünglich als C. ruffus katalogisiert worden war, konnte beschrieben werden. Die bekannten Exemplare stammen aus Grabag, Purworejo, Zentraljava, Indonesien. Die neue Art unterscheidet sich von allen anderen Gattungsangehörigen durch zahlreiche, auffällige morphologische Merkmale. Des Weiteren liegt nun eine detaillierte Beschreibung der Taxonomie-Geschichte der ähnlichen und nur vermeintlich weitverbreiteten C. ruffus vor. Scytale scheuchzeri (der Name bezieht sich auf die Beschreibung einer colubroiden Schlange) wurde aus der Synonymie von C. ruffus entfernt, C. rufa var. javanica (ein Taxon, das ursprünglich aus Borneo beschrieben worden war) als „species inquirenda“ eingestuft und die erst kürzlich beschriebene C. mirzae mit C. ruffus synonymisiert worden. Belege zur Untermauerung der Typuslokalität von C. ruffus als „Java“ wurden erbracht. Die Entdeckungen von C. subocularis und des Bogenfingergeckos Cyrtodactylus klakahensis aus Java zeigen, wie wenig wir eigentlich über die Artenvielfalt einer Insel wissen, auf der die herpetologische Erforschung Indonesiens immerhin schon vor zwei Jahrhunderten begann (Publikation 6). Die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Gattung Cylindrophis werden in einer laufenden Studie überprüft, bei der sowohl morphologische als auch molekularbiologische Methoden zum Einsatz kommen. Basierend auf Exemplaren, die ich in der Sammlung des Naturhistorischen Museums in London, UK, entdeckte, konnte ein neuer Verbreitungsnachweis für den Skink Sphenomorphus oligolepis für die Molukkeninsel Seram (Indonesien) erbracht werden. Es handelt sich um das westlichste Vorkommen dieser papuanischen Echse und dehnt ihr Verbreitungsgebiet weit in die Wallacea-Region aus (Publikation 7). Die Schwarznarbenkröte, Duttaphrynus melanostictus, die kürzlich in Madagaskar eingeführt wurde (Publikation 8), ist das Hauptobjekt der Forschung, die in Kapitel 6 präsentiert wird. Während der Freilandarbeit in Timor-Leste wurde eine Schwarznarbenkröte entdeckt, die eine Blumentopfschlange, Indotyphlops braminus, gefressen hatte. Dies wies darauf hin, dass sich diese kürzlich auch nach Timor eingeführte Kröte möglicherweise durch Prädation bestandsgefährdend auf kleine Wirbeltiere auswirken könnte, die in Timor einen außergewöhnlich hohen Grad an Endemismus zeigen (Publikation 9). Um diese potentielle Auswirkung zu bewerten, wurde der Darminhalt von über 80 zuvor konservierten Kröten aus fünf verschiedenen Habitattypen innerhalb Timor-Lestes untersucht, wobei fast 6000 Beutetiere identifiziert werden konnten. Unter diesen befanden sich ausschließlich Invertebraten aus verschiedenen taxonomischen Gruppen. Kleine staatenbildende Insekten konnten als Hauptbestandteil der Nahrung von D. melanostictus identifiziert werden. Das breite Beutespektrum weist darauf hin, dass es sich bei D. melanostictus um einen generalistischen Invertebratenfresser handelt. Obgleich die Schwarznarbenkröte im Allgemeinen keine Vertebraten zu fressen scheint, ist nicht auszuschließen, dass Vertebraten die eine morphologische Ähnlichkeit mit Invertebraten aufweisen (Typ „Wurm“), ins Nahrungsspektrum dieser Kröte passen. Daten zu den Endoparasiten von D. melanostictus wurden zusammen mit der Nahrungsanalyse präsentiert (Publikation 11). Obgleich von zahlreichen Forschern Informationen zur Nahrung und zu Endoparasiten von Froschlurchen auf der Grundlage von Untersuchungen des Gastrointestinaltraktes publiziert worden sind, wurde nie im Detail auf die Schnittführung eingegangen, die benutzt wird, um die Leibeshöhle von konservierten Exemplaren zu öffnen. Eine optimale Schnittführung, die den Zugang und das einfache Entfernen von Teilen des Verdauungstraktes bei in Flüssigkeiten fixierten Froschlurchen erlaubt, wurde vorgestellt. Dieser U-förmige Schnitt ist einfach durchzuführen und zu vermitteln und wurde bereits in Laborhandbüchern übernommen. Er ermöglicht einen besseren Zugang zu den relevanten Organen als ein kleiner ventrolateral durchgeführter Schnitt und hat eine weniger zerstörende Wirkung als der in Lehrbüchern routinemäßig aufgeführte mediane Schnitt in Form einer römischen I. Diese neue schonende Methode könnte andere Forscher dazu ermutigen, konservierte Froschlurche für Nahrungsanalysen und andere innere Untersuchungen zu nutzen und damit den wissenschaftlichen Gebrauch von Sammlungsexemplaren fördern. Für einen auf Timor vorkommenden Nachtskink (Gattung Eremiascincus) gelang zum ersten Mal die Zucht in Gefangenschaft, wobei sich zeigte, dass die Tiere lebendgebärend sind. Die Informationen zur Reproduktionsbiologie der Gattung Eremiascincus werden zusammengefasst bereitgestellt (Publikation 12). Dieses Wissen wird bei laufenden morphologischen und molekularbiologischen Revisionen ergänzend zum Einsatz kommen. Der Typus des Skinks Anomalopus leuckartii wurde in der herpetologischen Sammlung des Museums für Tierkunde Dresden, Deutschland, wiederentdeckt. Er gehört, zusammen mit anderen Exemplaren, zum Bestand der ehemaligen Sammlung von Karl Georg Friedrich Rudolf Leuckart, der einer der führenden Zoologen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war und als Begründer der modernen Parasitologie gilt. Diese Wiederentdeckung ist ein Paradebeispiel, das aufzeigt, wie wichtig es ist, naturkundliche Sammlungen zu erhalten und zwar nicht als statische Archive sondern als aktiv zu nutzende, wertvolle Datenbanken. Die Arbeit in und an Sammlungen, in Kombination mit der bestmöglichen taxonomischen Sachkenntnis, schafft ein produktives Umfeld, das Entdeckungen, wie sie in dieser Arbeit vorgestellten werden, maßgeblich fördert und damit unweigerlich auch die moderne Biodiversitätsforschung bereichert (Publikation 13). In einer „General Conclusions“ (Kapitel 8) werden die Effekte, die sich aus der Kombination bzw. Koordination von Freiland- und sammlungsbasierter Forschung ergeben, herausgearbeitet und in einer Übersichtsgrafik veranschaulicht. Sich zum Teil ergänzende Wechselwirkungen, Synergieeffekte und ein die Einzelarbeiten verbindender iterativer Prozess, sind die Kenngrößen, mit denen sich der Mehrwert der vorgelegten Arbeit beschreiben lässt. Abschließend wird der Nutzen für die Entscheidungsträger in Natur- und Artenschutz aufgezeigt.
 Publikationsserver
Publikationsserver