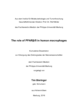The role of PPARβ/δ in human macrophages
Macrophages represent the most diverse cell type in biology. They adapt selectively to many stimuli allowing for precise functionality in any environment without harming the organism. Consequently, they monitor their surroundings carefully and react to a plethora of signals. Fatty acids and their de...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2016
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Makrophagen stellen den divergentesten Zelltyp dar. Sie beeinflussen und modellieren ihre Umgebung auf vielfältige Weise. Folglich müssen diese Zellen die auf sie wirkenden Umwelteinflüsse wahrnehmen und verarbeiten, um eine adäquate Adaptation zu gewährleisten. Nur so kann eine Schädigung des Organismus bei gleichzeitigem Erhalt der Funktionalität ausgeschlossen werden. Ein in diesem Kontext wichtiger Faktor ist die Verfügbarkeit und Zusammensetzung von Fettsäuren und ihren Derivaten, welche nebst anderen Signalen, auf den lipidregulierten Kernrezeptor Peroxisome Proliferator-Activated Receptor (PPARβ/δ) einwirken. Versuche in Mäusen haben gezeigt, dass dessen genetische Ablation dazu führt, dass Fettgewebs- und Leber- Makrophagen nicht mehr befähigt sind einen alternativen anti-inflammatorischen Aktivierungszustand einzunehmen. Diese Ergebnisse unterstreichen die wichtige Rolle von PPARβ/δ in Makrophagen und der Immunregulation. Dennoch liegen bis heute keine systematischen Studien, die sich auf die Rolle von PPARβ/δ in humanen Makrophagen fokussieren, vor. Die vorliegende Arbeit beschreibt die Rolle von PPARβ/δ in humanen Makrophagen inklusive seines transkriptionellen Netzwerks, das auf eine Vielzahl zellulärer Prozesse einwirkt. Zum einen wird dies durch die zelltypunabhängige kanonische Regulation bewirkt. Dabei bindet PPARβ/δ mit seinem obligatorischen Dimerisierungspartner Retenoid X Receptor (RXR) direkt an spezielle Stellen in den regulatorischen Regionen bereits bekannter und neubeschriebener spezifischer Zielgene, wodurch die Transkription durch Agonisten induziert und durch inverse Agonisten reprimiert wird. Zum anderen wird eine neue Klasse von nicht-kanonisch regulierten Zielgenen beschrieben. Diese Gene weisen keine chromatinassozierten PPARβ/δ Komplexe auf, werden durch Agonisten reprimiert und sind makrophagen-selektiv (inverse Regulation). Im Einklang mit der vorherrschenden Ansicht und der Induktion eines IL4-ähnlichen morphologischen Phänotyps durch Agonisten, inhibiert diese Art der Regulation pro-inflammatorische Funktionen. Überraschenderweise werden jedoch gleichzeitig auch anti-inflammatorische Gene, unter anderen CD32B, IDO1 und CD274 (PD-L1) reprimiert. Entsprechend konnte eine makrophagen-abhängige Stimulation der CD8+ T-Zell Aktivierung durch diese Liganden beobachtet werden. In Kombination deuten diese Beobachtungen auf eine besondere Rolle von PPARβ/δ mit kontextabhängiger Funktion in der Immunregulation hin. Der zweite Teil beschreibt das durch PPARβ/δ regulierte Transkriptom tumor-assoziierter Makrophagen (TAMs) aus dem Aszites von Patientinnen mit serösem Ovarialkarzinom. Beachtenswerterweise ist im Vergleich zu monozyten-abgeleiteten Makrophagen die Mehrheit der PPARβ/δ Zielgene überexprimiert und refraktär gegenüber Agonisten, was weder auf ein erhöhtes Proteinlevel noch die vermehrte Rekrutierung an Zielgene zurückzuführen ist. Der Einfluss von inversen Agonisten auf TAMs war gleichzeitig unverändert, was auf die Gegenwart von endogenen aktivierenden Liganden hindeutete. Analysen von Aszitesproben hinsichtlich der Lipidzusammensetzung offenbarten tatsächlich stark erhöhte Konzentrationen mehrfachungesättigter Fettsäuren, vor allem Linolsäure und Arachidonsäure. Diese Fettsäuren verursachten die Bildung von Lipidtröpfchen in Makrophagen, welche ihrerseits ein potentielles Reservoir für PPARβ/δ Agonisten darstellen könnten, was wiederum eine Erklärung für die Deregulierung von PPARβ/δ Zielgenen bietet. Unter den deregulierten Genen findet sich ANGPTL4, dessen erhöhte Expression mit einem verkürzten rezidivfreien Überleben assoziiert ist und somit die potentielle klinische Bedeutung dieser Beobachtungen unterstreicht.
 Publikationsserver
Publikationsserver