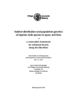Habitat distribution and population genetics of riparian Salix species in space and time – a restoration framework for softwood forests along the Elbe River
Riparian softwood forests belong to the most endangered vegetation types in Central Europe due to diverse river management measures (e.g. dyking, river training, etc.). As unmodified hydro-geomorphic processes along rivers are widely lacking, which are necessary to create competition-free establishm...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2012
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Weichholzauenwälder zählen zu den am stärksten bedrohten Vegetationstypen in Mitteleuropa, bedingt durch Maßnahmen zur Flussbewirtschaftung. An den meisten Flüssen fehlen unveränderte, hydrogeomorphologische Prozesse weitestgehend, welche notwendig sind, um konkurrenzfreie Etablierungsstandorte zu schaffen. Eine natürliche Regeneration der Weichholzauenarten ist daher kaum noch zu beobachten und somit sind Renaturierungsmaßnahmen dringend notwendig. Diese stellen jedoch vor dem Hintergrund unterschiedlicher Nutzungsinteressen von Wirtschaft, Gesellschaft und Naturschutz und wegen der ökologischen Ansprüche der Arten eine besondere Herausforderung dar. Ich habe meine Doktorarbeit im Rahmen eines Projektes erstellt, das die Entwicklung eines Konzepts zur Wiederansiedlung von Weichholzauen an der Mittleren Elbe unter Berücksichtigung ökologischer und hochwasserschutztechnischer Belange zum Ziel hatte. In verschiedenen Untersuchungen habe ich mich ökologischen sowie populationsgenetischen Aspekten verschiedener Weichholzauenarten gewidmet. Die Ergebnisse stellen eine wissenschaftliche Grundlage für Pflanzungsmaßnahmen dar, um deren Erfolg zu verbessern. Meine Doktorarbeit beinhaltet fünf Studien, die sich mit verschiedenen Fragestellungen zur Weichholzauenrenaturierung beschäftigen. In der ersten Studie wurden die ökologischen Zusammenhänge zwischen den Verbreitungsmustern der Weichholzaue und hydrologischen Variablen untersucht, basierend auf Habitatmodellen für zwei Vegetationstypen und zwei unterschiedliche Altersklassen. Die Modelle zeigten, dass die hydrologischen Variablen die Habitatverbreitung signifikant und zu großen Teilen erklären. Auf Grundlage der beobachteten ökologischen Muster werden Ratschläge für die Auswahl geeigneter Standorte für Pflanzungen gegeben. In der zweiten Studie, einem experimentellen Ansatz, wurden mögliche Effekte von Konkurrenz und Biomasseverlust auf die Regenerationsfähigkeit von Stecklingen verschiedener Salix-Arten getestet. Es zeigte sich, dass diese anfällig für Konkurrenz sind und zwar vor allem hinsichtlich jener um Licht. Dies weist darauf hin, dass Konkurrenz während der Etablierungsphase möglichst vermieden werden sollte, um den Erfolg von Pflanzungsmaßnahmen zu erhöhen. Die zusätzlich getestete Wiederaustriebsfähigkeit der untersuchten Auenarten zeigte enorme Wachstumskapazitäten. Daraus lässt sich folgern, dass Stecklinge für Pflanzungsmaßnahmen besonders geeignet sind. Da Pflanzungsmaßnahmen wegen ihres vermeintlichen Hochwasserrisikos Gegenstand vieler Diskussionen sind, wurde die dritte Studie durchgeführt, um die Effekte von Weichholzauenpflanzungen auf das Hochwasserrisiko zu überprüfen. Hierfür wurden Habitatmodelle mit einem zweidimensionalen hydraulisch-numerischen Modell kombiniert. Mittels dieses Ansatzes konnten wir zeigen, dass es möglich ist, Standorte zu identifizieren, die sowohl den Kriterien zur ökologischen als auch zur hydraulischen Eignung entsprechen. Schlussfolgernd kann ein bedeutendes Potenzial für „sichere“ Pflanzungen in wirtschaftlich genutzten Flussauensystemen erwartet werden. In der vierten Studie habe ich mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf die Habitatverfügbarkeit von Weichholzauenarten untersucht. Während die jetzigen Umweltbedingungen immer noch ein großes Potenzial für die Renaturierung von Weichholzauen aufweisen, zeigen Zukunftsprojektionen von Weichholzauenhabitaten, die auf durch den Klimawandel induzierten hydrologischen Veränderungen beruhen, einen Verlust von geeignetem Habitat. Dabei besteht vor allem eine große Unsicherheit bezüglich der Habitatverfügbarkeit für Renaturierungsmaßnahmen aufgrund der großen Variabilität der hydrologischen Projektionen. Dennoch sollte diese Unsicherheit für Renaturierungsmaßnahmen berücksichtigt werden, um Weichholzauen auch in Zukunft zu erhalten. Die gegenwärtigen natürlichen Populationsstrukturen/ –dynamiken der Weichholzauenarten weisen auf einen extrem kritischen Zustand hin, der die Langzeitpersistenz dieses Vegetationstypus in Frage stellt. Die Ergebnisse der fünften Studie, einer genetischen Populationsanalyse, sind weniger alarmierend. Hierfür habe ich die klonalen Muster sowie die genetische Diversität von Salix viminalis als Modellart untersucht. Obwohl klonale Strukturen verbreitet auftraten, war keine Dominanz einzelner Klone festzustellen. Die genetische Diversität der Bestände war prinzipiell hoch und es waren keine negativen Effekte der Auen- oder Bestandsfragmentierung hierauf erkennbar. Aus den beobachteten Mustern lassen sich Ratschläge für die Auswahl von Pflanzungsmaterial ableiten. Insgesamt liefern die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse eine solide Grundlage für Renaturierungsmaßnahmen von Weichholzauen auf der Basis von Pflanzungen. Da jedoch die Nachhaltigkeit solcher Maßnahmen sehr eingeschränkt ist, sollten ergänzend andere Maßnahmen zur Auenredynamisierung in Betracht gezogen werden, um dauerhaft den Selbsterhalt von Weichholzauen zu ermöglichen.
 Publikationsserver
Publikationsserver