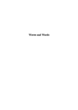Waves and Words: Oscillatory activity and language processing
Successful language comprehension depends not only on the involvement of different domain-specific linguistic processes, but also on their respective time-courses. Both aspects of the comprehension process can be examined by means of event-related brain potentials (ERPs), which not only provide a di...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2004
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Die erfolgreiche Verarbeitung von Sprache ist nicht nur abhängig von der effektiven Zusammenarbeit unterschiedlicher domänenspezifischer linguistischer Prozesse, sondern in wesentlichem Maße auch von deren jeweiligen zeitlichen Verlauf. Die Erfassung der elektrischen Gehirnaktivität beim Menschen mittels ereigniskorrelierter Potentiale (EKPs) als Korrelat sprachlicher Verarbeitungsprozesse erlaubt eine millisekundengenaue Differenzierung und Zuordnung unterschiedlicher sprachlicher Verarbeitungsdomänen. Neuere Befunde aus EKP-Experimenten zeigen jedoch, dass die erhoffte eins-zu-eins Korrelation zwischen EKP-Komponenten und linguistischen Prozessen nicht mehr aufrecht zu erhalten ist und daher eine interpretatorische Unschärfe ensteht. Die in meiner Dissertation vorgeschlagene Methodik einer frequenzanalytischen Untersuchung von EKP-Komponenten hat das Ziel, diese interpretatorische Unschärfe zu beheben. Zu diesem Zweck wird eine für die elektroenzephalographische (EEG) Untersuchung von Sprachverstehensprozessen neue Analysetechnik vorgestellt, die die klassischen EKP-Maße mit korrespondierenden frequenzbasierten Analysen ergänzt. Die Ergebnisse liefern Evidenz dafür, dass eine frequenzanalytische Dissoziation von EKP-Komponenten mittels der eingeführten Methode möglich ist. Darüber hinaus gestattet eine Beschreibung der den EKPs zugrundeliegenden Frequenzeigenschaften (Power vs. Phasenkopplung) weiterführende Einsichten bezüglich der funktionalen Organisation unseres Sprachverstehenssystems und seiner inhärenten Komplexität. Die Durchführung und Auswertung von insgesamt 5 EEG Experimenten führte zu folgenden Ergebnissen: (1) Sprachliche EKP-Komponenten, die aus einer Oberflächenperspektive nicht voneinander zu unterscheiden sind (Experiment 1), lassen sich auf der Basis der ihnen zugrundeliegenden Frequenzeigenschaften (Frequenzband, Power, Phasenkopplung) voneinander dissoziieren. Damit kann die interpretatorische Vagheit von EKP Komponenten aufgelöst werden. (2) Der klassische lexikalisch-semantische N400-Effekt lässt sich anhand seiner Frequenzeigenschaften eindeutig beschreiben und spezifischen Frequenzkorrelaten zuordnen lässt, so dass eine erste interpretatorische Zuordnung des N400-Effekts im Hinblick auf die ihm zugrundeliegende neuronale Prozess-Dynamik möglich erscheint. (3) Lexikalisch-semantische N400-Effekte unterscheiden sich von N400-ähnlichen Effekten, die nicht der Domäne semantisch-interpretativer Prozesse zugeordnet werden können, auf der Basis ihrer jeweiligen Frequenzeigenschaften voneinander. In den Experimenten 2 bis 5 wurde die Verarbeitung von Antonym-Relationen untersucht. Während in Experiment 2 Antonym-Wortpaare (schwarz - weiß) im Vergleich zu relatierten (schwarz - gelb) und nicht-relatierten (schwarz - nett) Wortpaaren in einem Satzkontext präsentiert wurden, wurden in den Experimenten 3 bis 5 dieselben Stimuli als isolierte Wortpaare dargeboten. Die frequenzanalytische Auswertung der Experimente ergab, dass die erzielten lexikalisch-semantischen N400-Effekte bezüglich der ihnen inhärenten Frequenzeigenschaften keine monolithischen Effekte darstellen, sondern sich durch eine Überlagerung funktional unterschiedlicher Frequenzkomponenten manifestieren. Ein aufgabenbezogener Effekt spiegelte sich in einer spezifischen Frequenzbandmodulation wider, die im EKP zu einer P300-ähnliche Positivierung führte. Hingegen korrelierten lexikalisch-semantische Verarbeitungsprozesse unabhängig von den experimentellen Randbedingungen mit einer Erhöhung in einem anderen Frequenzband. In Experiment 2 und 3 trat der aufgabenrelatierte Positivierungs-Effekt im Zeitbereich der N400 auf, so dass es zu einer zeitlich-räumlichen Überlagerung der beiden Komponenten kam. Im Gegensatz dazu trat in Experiment 5 eine aufgabenrelatierte Positivierung lediglich bei der Verarbeitung von Pseudowörtern und in Abhängigkeit einer zeitlich vorangegangenen N400 auf. Zusammengefasst sprechen die Ergebnisse dafür, dass N400-Effekte nicht als monolithische Effekte angesehen werden sollten. In Abhängigkeit von externen und stimulusbedingten Faktoren erscheint der N400-Effekt als das Resultat einer Überlagerung von mehreren funktional unterschiedlichen Aktivierungsprozessen, die jedoch anhand der ihnen zugrunde liegenden Frequenzeigenschaften voneinander dissoziiert sind. In diesem Sinne haben die hier vorgestellten frequenzbasierten Verfahren einen direkten sprachwissenschaftlichen Bezug mit unmittelbaren Konsequenzen für die psycholinguistische Theoriebildung. Unter der Annahme, dass in etlichen experimentellen Befunden sprachliche Verarbeitungsprozesse aufgrund des bloßen Auftretens einer N400 sogleich der lexikalisch-semantischen Verarbeitungsdomäne zugeschrieben wurden, erfordern diese Ergebnisse sowohl eine Reinterpretation der Datenlage als auch der sprachtheoretischen Interpretation.
 Publikationsserver
Publikationsserver