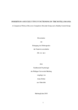Inhibition and executive functioning in trichotillomania: A comparison with an obsessive-compulsive disorder group and a healthy control group
Trichotillomania (TTM) is characterized by repetitive hairpulling which causes significant distress or functional impairment. Currently classified as an impulse-control disorder, TTM has also been categorized as an obsessive-compulsive spectrum disorder based on phenomenological and neurobiological...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2003
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Einleitung Trichotillomanie (TTM) bezeichnet repetitives Haareusreißen, das beträchtliches Leiden hervorruft oder zu einer signifikanten Funktionseinschränkung führt. Diese Störung gilt als Impulskontrollstörung, ist aber aufgrund von Ähnlichkeiten auch dem Zwangsstörungsspektrum zugeordnet worden. Bei Zwangsstörungen (ZS) deuten Studienergebnisse auf kognitive Funktionsstörungen hin, v.a. Beeinträchtigungen in der Unterdrückung von Gedanken und exekutive Funktionsstörungen. Die vorliegende Forschungsarbeit geht der Frage nach, ob TTM auch durch Auffälligkeiten in kognitiven Funktionen gekennzeichnet ist und ob diese störungsspezifisch sind. Aufgrund des Störungsbildes erscheint es naheliegend, (1) die Fähigkeit zur intentionalen Impulskontrolle bei TTM zu untersuchen. Zudem ist es aufgrund der vermuteten Ähnlichkeiten zwischen TTM und ZS sinnvoll, (2) die Fähigkeit zur intentionalen Hemmung von Kognitionen und (3) die Integrität exekutiver Funktionen bei Personen zu untersuchen. Methode An der Untersuchung nahmen 26 TTM-, 22 ZS- und 26 gesunde Kontrollpersonen (GK) teil. Einige Probanden waren mit einzelnen Tests vertraut, ihre Testdaten wurden von der Auswertung ausgeschlossen. Mit einem GoNogo-Experiment wurde die Fähigkeit zur intentionalen Hemmung von motorischen Impulsen untersucht. Es wurden dazu zwei Arten von Stimuli in pseudo-randomisierter Abfolge präsentiert. Auf den 'GO'-Reiz sollten die Patienten mit einem möglichst schnellen Tastendruck reagieren, auf den 'NOGO'-Reiz sollte kein Tastendruck erfolgen. Falsch-positive Reaktionen sind Ausdruck beeinträchtigter motorischer Impulskontrolle. Zur Überprüfung der Fähigkeit zur intentionalen Hemmung von Kognitionen wurde ein Directed Forgetting-Experiment durchgeführt. Bei diesem Experiment wird der Gedächtnisabruf von Wörtern, die explizit erinnert werden sollen ('REMEMBER'-Wörter), verglichen mit dem Gedächtnisabruf von Wörtern, die nach vorheriger Enkodierung absichtlich vergessen werden sollen ('FORGET'-Wörter). Im Falle einer unbeeinträchtigten Inhibitionsfähigkeit sollten beim Free Recall mehr REMEMBER- als FORGET-Wörter erinnert werden. Eine neuropsychologische Testbatterie wurde eingesetzt, um verbale und räumlich-konstruktive Fähigkeiten, Gedächtnisleistungen und exekutive Funktionen zu untersuchen. Die Testbatterie umfasste Subtests der 'Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised' und der 'Wechsler Memory Scale' sowie den 'Rey-Osterrieth Complex Figure Test', 'California Learning Test', 'Tower of Hanoi', 'Object Alternation Task' und 'Wisconsin Card Sorting Test'. Ergebnisse Es gab keine signifikanten Gruppenunterschiede hinsichtlich Alter oder Anzahl der Bildungsjahre. Die klinischen Gruppen zeigten jedoch im Vergleich zu GK signifikant höhere Depressions- und Angstwerte. Der Frauenanteil war in der TTM-Gruppe signifikant höher als in den anderen Gruppen. In der Bearbeitung des GoNogo zeigten ZS und GK einen positiven Zusammenhang von Reaktionszeit und Gesamtfehlerzahl, was darauf hindeutet, dass diese Probanden das Experiment entweder schnell und fehlerarm (i.e. kompetent) oder langsam und fehlerreich (i.e. inkompetent) ausführten. Dieser Zusammenhang war in der TTM-Gruppe negativ, was darauf hindeutet, dass TTM-Probanden das Experiment entweder schnell und fehlerreich (i.e. impulsiv) oder langsam und fehlerarm (i.e. vorsichtig) ausführten. Der Korrelationskoeffizient der TTM-Gruppe unterschied sich signifikant von den anderen Gruppen. Die Ergebnisse sprechen für ein heterogenes Leistungsprofil in der TTM-Gruppe. Post hoc-Analysen ergaben, dass Probanden mit einer 'impulsiven' Bearbeitung signifikant früher an TTM erkrankt waren als Probanden mit einer 'vorsichtigen' Bearbeitung. Im Unterschied zu GK und TTM erinnerten ZS-Probanden im Directed Forgetting-Experiment von den FORGET-Wörtern signifikant mehr negative als neutrale Wörter. Es fiel den Personen mit einer ZS demnach speziell schwer, negative Wörter absichtlich zu vergessen. Zusätzlich bewertete die GK im Gegensatz zu den klinischen Gruppen die erinnerten Wörter signifikant positiver als die nicht-erinnerten Wörter. TTM- und ZS-Personen scheinen demnach nicht die Fähigkeit bzw. Neigung zu besitzen, positiv-valente Information vorrangig zu erinnern. TTM-Probanden fiel es im Object Alternation Task schwerer als GK, die erforderliche alternierende Reaktionsfolge aufzubauen, was für eine Beeinträchtigung in der Reaktionsflexibilität bei TTM spricht. Im Gegensatz dazu zeigten ZS-Probandenn im Vergleich zu GK eine beeinträchtigte Fähigkeit, im Wisconsin Card Sorting Test aus Feedback zu lernen. Es gab keine signifikante Gruppenunterschiede in verbalen oder visuell-räumlichen Fähigkeiten, Gedächtnisleistungen, der Fähigkeit, komplexes verbales und nonverbales Material zu organisieren, oder der Fähigkeit zum Planen und Problemlösen. Diskussion Insgesamt sprechen die Ergebnisse für TTM-spezifische Beeinträchtigungen in kognitiven Funktionen. Im Gegensatz zu ZS und GK scheint bei TTM die Reaktionsflexibilität eingeschränkt und die Fähigkeit zur intentionalen Hemmung motorischer Impulse vom persönlichen Impulsivitätsausmaß abhängig zu sein. Es ergeben sich Hinweise, dass TTM-Personen mit einer größeren Impulsivität einen früheren Störungsbeginn aufweisen. Im Gegensatz zu ZS scheint TTM jedoch nicht mit einer Beeinträchtigung in der intentionalen Hemmung von Kognitionen einher zu gehen. Sowohl bei TTM- als auch bei ZS-Personen scheint im Kontrast zu GK nicht die Neigung zu bestehen, positiv-valente Information vorrangig zu erinnern, was eventuell ein generelles Charakteristikum emotionaler Störungen ist. Insgesamt scheinen kognitive Dysfunktionen bei TTM eine Rolle zu spielen.
 Publikationsserver
Publikationsserver