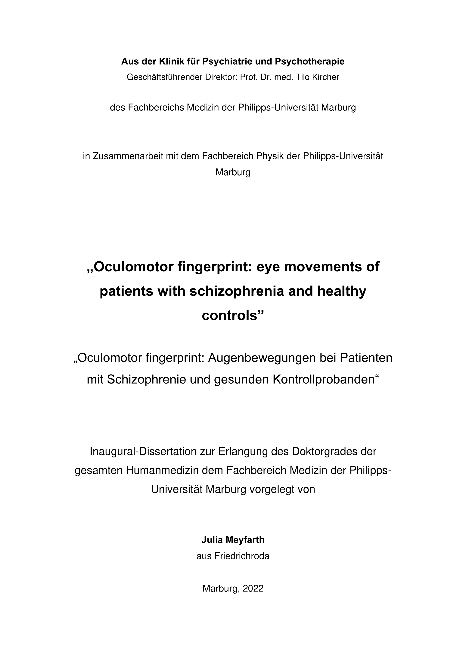Oculomotor fingerprint: eye movements of patients with schizophrenia and healthy controls
Eye movements of patients with schizophrenia have been examined for already more than 100 years under laboratory conditions; investigations in natural environment, however, have only been started recently. This study, designed as follow-up to the first project that measured eye movements of schizoph...
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Andre forfattere: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
Philipps-Universität Marburg
2022
|
| Fag: | |
| Online adgang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
Augenbewegungen von Schizophreniepatienten werden bereits seit über 100 Jahren unter Laborbedingungen untersucht, wohingegen Untersuchungen in natürlicher Umgebung erst seit kurzem durchgeführt werden. Diese Studie, die als Folgestudie zur näheren Untersuchung von Augenbewegungen in natürlicher Umgebung geplant worden ist, zeichnet sich dadurch aus, dass sie erstmalig beide Untersuchungsbedingungen miteinander kombinieren konnte. Bei allen Studienteilnehmern – 25 Patienten mit der Diagnose Schizophrenie (ICD-10) und 25 Kontrollprobanden, gematcht nach Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, Intelligenz (IQ) und städtischem Einfluss – wurden die glatten Augenfolgebewegungen (Smooth Pursuit) bei der Durchführung einer spezifischen Aufgabe, sowohl im Labor als auch (in angepasster Form) im natürlichen Umfeld untersucht. Darauf folgend wurden die Teilnehmer angehalten, verschiedene einfache Alltagsaktivitäten zu absolvieren. Sie konnten sich völlig frei bewegen, während sie einen Korridor entlangliefen (Free Viewing Task) und ferner ein Ziel mit den Augen während des Laufens verfolgten (Tracking). Okulomotorische Parameter wurden dabei von der EyeSeeCam, einem mobilen videobasierten Eye-Tracker, kontinuierlich und binokular aufgezeichnet, während Gain und RMSE der glatten Augenfolgebewegungen sowie Sakkaden, Fixierungen, Zwinkern und Augengeschwindigkeiten anschließend berechnet wurden. Um den möglichen Einfluss des Vestibularsystems auf die Augenbewegungen bei Schizophrenie besser einschätzen zu können, absolvierten alle Teilnehmer einen zweiten Durchlauf mit eingeschränkter Kopfbewegung (Nackenstütze/Kinnstütze). Die Ergebnisse des Trackings, dessen Aufgabe in Bezug auf die frühere Studie erstellt worden ist, konnten auch deren Resultate widerspiegeln: signifikant erhöhter RMSE bei normalem, den Literaturwerten widersprechendem, Gain. Interessant war auch das Ergebnis der Smooth Pursuit Untersuchung im Labor, im Vergleich zur natürlichen Umgebung. Entgegen aller Erwartungen erzielten beide Aufgaben ähnliche, wie im Tracking beschriebene, Resultate. Kopfeinschränkungen schienen ebenfalls keine bedeutenden Auswirkungen zu haben. Während des Free Viewings waren vor allem die Amplitude, die Spitzen- und Durchschnittsgeschwindigkeit von Sakkaden sowie die horizontale Augengeschwindigkeit bei Patienten signifikant verringert. Bei näherer Betrachtung der am stärksten betroffenen Patienten, die in Abhängigkeit von ihren Ergebnissen in psychologischen Bewertungsskalen (SANS und SAPS) in eine Gruppe mit positiven und eine mit negativen Symptomen eingeteilt wurden, konnten diese Ergebnisse bestätigt werden. Tatsächlich scheinen die Abnahme der Sakkadenamplitude eher mit Negativsymptomen verbunden zu sein, während verlangsamte Sakkaden- und Augengeschwindigkeiten, ebenso wie die Sakkadendauer und der Q-Wert aufgrund von Fehlfunktionen entstehen, die mit Positivsymptomen assoziiert sind. Die auffälligen Augenbewegungen im Labor sowie im realen Leben lassen auf eine, durch die Erkrankung bedingte, weitreichende neuronale Fehlfunktion schließen. Überraschenderweise konnten alle Ergebnisse nur bei freier Beweglichkeit von Augen, Körper und Kopf nachgewiesen werden, während eine Kopfbewegungseinschränkung zu kongruenten Ergebnissen beider Gruppen führte. Beim direkten Vergleich zwischen eingeschränkter und freier Kopfbeweglichkeit innerhalb derselben Gruppe konnten vorwiegend reduzierte Fixierungen bei verminderter Kopfbeweglichkeit nachgewiesen werden; Unterschiede in den Sakkaden- und Geschwindigkeitsparametern waren jedoch nicht ersichtlich. Nichtsdestotrotz scheint die stabilisierende Wirkung der Halskrause das okulomotorische System positiv zu beeinflussen. Daher sollte der Einfluss der zugehörigen Bewegungssysteme (vestibuläres, sensorisches, visuelles) auf die Augenbewegungen zukünftig weiter erforscht sowie die Suche nach zusätzlichen Kompensationsmechanismen vorangetrieben werden. Es wäre vorstellbar, dass in naher Zukunft die Zuverlässigkeit der Diagnose- und Prognosestellung einer Schizophrenie durch eine kurze Untersuchung der Augenbewegungen unterstützt werden könnte.
 Publikationsserver
Publikationsserver