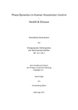Phase Dynamics in Human Visuomotor Control - Health & Disease
In this thesis, comprised of four publications, I investigated phase dynamics of visuomotor control in humans during upright stance in response to an oscillatory visual drive. For this purpose, I applied different versions of a ‘moving room’ paradigm in virtual reality while stimulating human partic...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2022
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Im Rahmen dieser Arbeit, welche sich aus vier experimentellen Studien zusammensetzt, habe ich das Phasenverhalten des menschlichen visuomotorischen Systems während des aufrechten Stands in Antwort auf visuelle Bewegungsreize untersucht. Hierfür verwendete ich verschiedene Varianten des ‚Moving Room‘-Paradigmas, welches ich in virtueller Realität (VR) simulierte. Während sich das visuelle Umfeld meiner Proband:innen in unterschiedlicher Weise in anterior-posteriorer (a-p) Richtung bewegte, zeichnete ich die Körperbewegungen auf, mit denen sie darauf reagierten. Das Halten unseres Gleichgewichts während des aufrechten Stands bedarf eines komplexen Zusammenspiels vieler voneinander abhängiger Prozesse. Die wichtigsten Sinne, welche uns hierfür zur Verfügung stehen, sind unser Sehsinn, die Signale unseres Vestibularorgans (Gleichgewichtssinn) sowie unsere Propriozeption. Hierbei wird unserem Sehsinn eine dominante Rolle zugeschrieben. Die Aufgabe unseres sensomotorischen Systems ist es, unseren Körperschwerpunkt (engl.: Center Of Mass, COM) in eine situationsabhängige Gleichgewichtsposition zu bringen und dort zu halten. Da sich unsere Umwelt fortlaufend verändert und unsere Sinneseindrücke mit einem Grundrauschen versehen sind, schwankt unser Körper typischerweise kontinuierlich um diesen Gleichgewichtspunkt. In Bezug auf diese Bewegung kann der menschliche Körper als umgedrehtes (mehrgliedriges) Pendel aufgefasst werden. Nehmen wir durch Störungen unseres visuellen Umfelds eine Bewegung unseres Körpers wahr, so regulieren wir besagtes Schwanken, um der wahrgenommenen Bewegung entgegenzuwirken. Neurodegenerative Krankheiten wie Morbus Parkinson beeinträchtigen diese Mechanismen und somit einen stabilen aufrechten Stand. Aus diesem Grund ermöglichen Untersuchungen von Körperbewegungen in Antwort auf visuelle Bewegungsreize Einblicke in die visuomotorische Verarbeitung in gesunden und neuropathologischen Populationen. In meiner ersten Studie führte ich eine neue Methode der Datenanalyse ein, mit welcher ich die Phasenkohärenz der körperlichen Antworten auf oszillatorische visuelle Bewegungsreize zwischen einzelnen Versuchsdurchläufen (engl.: Trials) untersuchte (engl.: Inter-trial Phase Coherence, ITPC). Ich fand heraus, dass menschliche Proband:innen die Phase der Bewegung ihres Druckschwerpunktes auf dem Boden (engl.: Center Of Pressure, COP) an den periodischen visuellen Reiz koppelten. Der Stimulus bestand aus einer 3-D Punktewolke, welche in a-p Richtung oszillierte. Diese Kopplung trat sowohl bei einer niedrigen Frequenz der visuellen Oszillation von 0,2 Hz als auch bei einer hohen Frequenz von 1,5 Hz auf. Dabei überstiegen die von mir gefundenen Kopplungen an die Frequenz von 1,5 Hz das bisher angenommene Spektrum kohärenter Antworten auf eine periodische Schwingung der Umwelt (‚moving room‘) bei menschlichen Körperschwankungen. Ich konnte zeigen, dass ITPC als neue Analysemethode im Kontext von Körperbewegungen erlaubt, verlässliche Antworten bei fast allen Proband:innen nachzuweisen, wodurch es mir zusätzlich gelang, das in diesem Forschungsfeld gängige Problem einer hohen Varianz der Antworten über Proband:innen hinweg zu adressieren. Meine Ergebnisse legen nahe, dass Phasenkopplung einen wichtigen Bestandteil der menschlichen Gleichgewichtskontrolle darstellt. Im Rahmen der zweiten Studie entwickelte ich einen neuen, mobilen und kostengünstigen Versuchsaufbau, um visuelle Bewegungsreize in virtueller Realität zu präsentieren und dabei Körperbewegungen aufzuzeichnen. Das neue Versuchs-Paradigma bestand hier aus einem virtuellen Tunnel, welcher sich in die a-p Richtung erstreckte. Im Experiment oszillierte der Tunnel mit einer von drei verschiedenen Frequenzen (0,2 Hz; 0,8 Hz; 1,2 Hz) vor und zurück. Da ein alleiniges Aufzeichnen des COP unzureichende Informationen dazu liefert, wie Bewegungen des COM realisiert werden, implementierte ich zusätzlich ein mit dem VR-Setup synchronisiertes video-basiertes Bewegungsmesssystem, welches mir erlaubte, die Bewegungsantworten des gesamten Körpers aufzuzeichnen. In dieser Studie verwendete ich eine leicht modifizierte Analyse zu Phasenkopplungen, den sogenannten ‘Phase-Coupling Value‘ (PLV). Mithilfe dieser Analyse fand ich heraus, dass Proband:innen nicht nur die Bewegung ihres COP, sondern auch die Bewegung einzelner Körpersegmente an die Phase des visuellen Reizes koppelten. Während diese Kopplung im Falle des COP bei allen präsentierten Frequenzen deutlich vorhanden war, zeigten die Antworten bestimmter Körperteile mit steigender Frequenz unterschiedlich starke Kopplungen. Bei der niedrigsten Frequenz von 0,2 Hz koppelten die Proband:innen die Phase der Bewegung ihres nahezu ganzen Körpers an den visuellen Reiz. Mit steigender Frequenz konzentrierte sich die Phasenkopplung auf den unteren Torso und die Hüfte, während die Proband:innen bei der höchsten Frequenz von 1,2 Hz beinahe nur noch ausschließlich ihre Hüftbewegung an die Phase des Reizes koppelten. Mein neuartiger Versuchsaufbau und die Analysemethode der Phasenkopplung ermöglichten es mir somit, frequenzabhängige Bewegungsmuster als Antworten auf die visuellen Reize nachzuweisen, wodurch ich bestehende Theorien empirisch belegen konnte. In der dritten Studie, welche als Kollaboration mit der Klinik für Neurologie des Unversitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) durchgeführt wurde, verwendete ich denselben Versuchsaufbau und das gleiche Paradigma wie in der vorherigen Studie. Zusätzlich errechnete ich in dieser Studie die Trajektorie des COM als gewichtete Kombination bestimmter Körpersegmente. Ziel dieser Studie war es, die Phasenkopplung von Körperschwingungen in einer Gruppe von Parkinson-Patient:innen zu untersuchen, um langfristig dabei mitzuwirken, Methoden für eine mögliche Früherkennung der Krankheit zu entwickeln. Zu diesem Zweck untersuchte ich eine Gruppe von Patient:innen, eine Gruppe von gleichaltrigen, gesunden Kontrollproband:innen sowie eine Gruppe von jungen, gesunden Erwachsenen. Patient:innen zeigten eine deutlich erhöhte Amplitude ihrer Körperbewegungen, koppelten jedoch die Phase ihres COP und auch ihres COM in gleicher Weise an den Stimulus wie beide Kontrollgruppen. Eine Untersuchung der Bewegung einzelner Körperteile ergab hier jedoch, dass die in der zweiten Studie beschriebenen Bewegungsmuster in Antwort auf höhere Frequenzen in den einzelnen Gruppen unterschiedlich waren. Während die junge Kontrollgruppe, analog zu den Proband:innen meiner zweiten Studie, ihr Bewegungsmuster an die höheren Frequenzen anpasste bzw. wechselte, behielten sowohl die Patient:innen als auch die gleichaltrige Kontrollgruppe ein eher homogenes Bewegungsmuster bei, auch bei den beiden höheren Frequenzen des visuellen Reizes. Dies ließ mich auf eine erhöhte körperliche Steifigkeit schließen, welche jedoch ein Effekt des Alters und nicht der Krankheit zu sein scheint. Generell folgerte ich aus den Ergebnissen dieser Studie, dass Parkinson-Patient:innen in frühen Stadien der Krankheit zwar eine beeinträchtigte Motorik zeigen, was sich in ihrer erhöhten Bewegungsamplitude widerspiegelt, sie jedoch keine Beeinträchtigung in ihrer visuomotorischen Verarbeitung aufweisen, da sie prinzipiell noch immer in der Lage sind, die Phase ihrer Körperbewegung an den visuellen Reiz zu koppeln. In der vierten Studie, in welcher ich als Zweitautor mitwirkte, nutzten wir Daten, welche wir in einem in der dritten Studie zusätzlich verwendeten Paradigma erhoben hatten. Dieses Paradigma bestand aus einer kontinuierlichen, aber unvorhersehbaren a-p Bewegung des virtuellen Tunnels. Anhand dieser Daten untersuchten wir die Geschwindigkeitsprofile des COP und COM in Antwort auf die unvorhersehbare Bewegung sowie auf eine Kontrollbedingung, während welcher der Tunnel stillstand. Patient:innen zeigten im Vergleich zu den Kontrollgruppen erhöhte Geschwindigkeiten beider Parameter (COP und COM) unter beiden visuellen Bedingungen. Untersuchungen der Geschwindigkeitserhöhung beider Parameter als Effekt der unvorhersehbaren Bewegung des Tunnels ergaben einen Anstieg der mittleren Geschwindigkeit des COP bei Patient:innen und der gleichaltrigen Kontrollgruppe, jedoch keine Veränderung bei der jungen Kontrollgruppe. Die mittlere Geschwindigkeit des COM änderte sich bei keiner der Gruppen. Dies ließ uns schlussfolgern, dass alle Gruppen bei unvorhersehbaren Störungen ihres visuellen Umfelds in der Lage waren, ihr Gleichgewicht zu halten. Jedoch mussten Patient:innen und ältere Kontrollproband:innen hierfür einen gesteigerten Aufwand betreiben, was sich in der erhöhten mittleren Geschwindigkeit ihres COP zeigte. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten erneut einen Alters-, jedoch keinen Krankheits-Effekt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass meine neu in der Forschung zu Stand- und Gangverhalten eingeführte Analysemethode der Phasenkopplung sowie das gleichzeitige Aufzeichnen mehrerer Bewegungsparameter es mir erlaubten, neue Erkenntnisse über die visuomotorische Verarbeitung beim Menschen zu gewinnen. Zum einen konnte ich gängige Probleme von inkonsistenten Bewegungsantworten innerhalb von untersuchten Personengruppen überwinden. Zum anderen konnte ich zeigen, dass Phasenkopplung ein essenzieller Bestandteil der visuomotorischen Verarbeitung zu sein scheint, was mir zusätzlich ermöglichte, bestehende Theorien der posturalen Kontrolle beim Menschen empirisch zu bestätigen. Zusätzlich konnte ich durch Studien in Kollaboration mit der Klinik für Neurologie des UKGM neue Aspekte der visuomotorischen Verarbeitung bei Morbus Parkinson untersuchen, wodurch ich zu einem besseren Verständnis von sensomotorischen Aspekten der Krankheit beitragen konnte.
 Publikationsserver
Publikationsserver