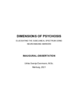Dimensions of psychosis: Elucidating the subclinical spectrum using neuroimaging markers
Psychosis unifies a collective of disorders characterised by symptom dimensions (Gaebel & Zielasek, 2015). Purposefully delimited clinical descriptors of schizophrenia spectrum and psychotic disorders (American Psychiatric Association, 2013) impose challenges on the identification of aetiologica...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2020
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Unter dem Sammelbegriff der Psychosen versteht sich eine Gruppe von Störungen mit vielfältigen Symptomen (Gaebel & Zielasek, 2015). Fall-Kontroll-Studien untersuchen anhand kategorialer Diagnosen (American Psychiatric Association, 2013) neurobiologische Veränderungen einhergehend mit psychotischen Erkrankungen. Im dimensionalen Krankheitsverständnis beruht die Bezeichnung klinischer Phänotypen auf der Annahme eines Kontinuums unterschiedlicher Symptome (Stefanis et al., 2002; Verdoux & van Os, 2002). Dieser dimensionale Ansatz kann das Auftreten psychotischer Merkmale bei Gesunden erklären und gleichzeitig zur erweiterten Erforschung ätiologischer Modelle genutzt werden (Barrantes-Vidal et al., 2015; Nelson et al., 2012). Zu den subklinischen Phänotypen gehören einerseits stabile Merkmale wie schizotype Traits (Mason et al., 1995), so wie vermeintlich transiente psychose-nahe Erlebnisse (Linscott & van Os, 2013; Stefanis et al., 2002). Mittels hirnmorphometrischer Methoden können neuroanatomische Parallelen und Abgrenzungen zu den klinischen Krankheitsbildern untersucht werden (Nenadić, Lorenz, et al., 2015; Siever & Davis, 2004; Taylor et al., 2020). Drei Querschnittstudien untersuchten mögliche Zusammenhänge zwischen psychometrisch erfassten subklinischen Psychose-Phänotypen und der kortikalen Struktur. Studie 1 widmete sich der Analyse der kortikalen Oberflächengyrierung, welche einen Indikator für die frühe kortikale Entwicklung in Abhängigkeit von genetischen und Entwicklungsfaktoren (Docherty et al., 2015; Haukvik et al., 2012) darstellt. Diese wurde im Zusammenhang mit dimensionalen psychose-nahen Erlebnissen untersucht. Die kortikale Faltung erklärt auch spätere kognitive Leistungen (Gautam et al., 2015; Hedderich et al., 2019; Papini et al., 2020), welche bei PatientInnen, Hoch-Risiko Phänotypen und Gesunden mit einem familiären Psychoserisiko Verschlechterungen aufweisen (Hou et al., 2016; Siddi et al., 2017). Anhand von Mediationsmodellen wurde der Einfluss neurokognitiver Funktionen auf den Zusammenhang zwischen regionaler Gyrifizierung und psychose-nahen Erlebnissen untersucht. Studien 2 und 3 untersuchten hirnstrukturelle Korrelate anhand von Voxel-basierter Morphometrie. Studie 3 verfolgte das Ziel, sowohl die Ausprägung als auch die Facette des entstandenen Belastungsgrades durch subklinische Erlebnisse (Hanssen, Bak, et al., 2005; Ising et al., 2012) auf der hirnstrukturellen Ebene abzubilden. Die Auswirkung des Zusammenspiels dieser beiden Facetten (Ausprägung und dimensionsspezifische Belastung) auf die Struktur präfrontaler Areale wurde mit Moderationsanalysen untersucht. Basierend auf bestehenden Ergebnissen zur Reduktion hippocampaler Volumina in den frühen und späten Stadien psychotischer Erkrankungen (Lieberman et al., 2018; Mathew et al., 2014; Schobel et al., 2013), sowie bei der Schizotypie Gesunder (Sahakyan et al., 2020), untersuchte Studie 3 die medial temporalen Strukturen. Es wurden die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Schizotypie-Dimensionen und subklinischen psychose-nahen Erlebnissen, sowie deren Interaktion, mit den Volumina einzelner hippocampaler Teilvolumina und der Amygdala untersucht. Die Ergebnisse zeigten unterschiedliche regionale oberflächenbasierte Korrelate der kortikalen Faltung in Abhängigkeit von der Merkmalsdimension. Reduktionen der kortikalen Gyrierung in parietalen und temporalen Bereichen stimmten mit den Regionen neuroanatomischer Veränderungen aus klinischen Studien bei Schizophrenie-PatientInnen überein. Der Effekt der Gyrierung auf die Ausprägung subklinischer Phänotypen in diesen und präfrontalen Bereichen wurde jedoch nicht durch die kognitive Leistung vermittelt. Studie 2 zeigte, dass die Ausprägung des subklinischen Phänotyps, jedoch nicht die mit solchen Erlebnissen verbundene Belastung, mit einer Zunahme der grauen Substanz in präfrontalen und okzipitotemporalen Arealen assoziiert waren. Eine Volumenreduktion im Gyrus frontalis superior wurde durch die Interaktion der subklinischen Phänotyp Ausprägung mit der Belastung durch perzeptuelle Merkmale bedingt. Hinsichtlich der Assoziationen in den medial temporalen Strukturen konnte gezeigt werden, dass strukturelle Variation der Amgygdala und einzelner hippocampaler Teilvolumina eher durch stabile schizotype Traits, als durch psychose-nahe Erlebnisse, erklärt wird. Im hippocampalen Subiculum moderierte positive Schizotypie jedoch den Zusammenhang zwischen transienten Erlebnissen und Volumenzunahme. Somit hebt Studie 3 die besondere Rolle stabiler Endophänotypen (Barrantes-Vidal et al., 2015) sowie die Berücksichtigung der Dimensionalität subklinischer Phänotypen (Grant, 2015; Vollema & van den Bosch, 1995) im Psychosespektrum hervor. Die Ergebnisse der drei Studien unterstützen den dimensionalen Ansatz, bei dem unterschiedliche psychotische Merkmale im Einzelnen untersucht werden. Diese psychose-nahen Erlebnisse wiesen bei Gesunden kortikale Assoziationen in psychose-relevanten präfrontalen und temporalen Arealen auf (Haijma et al., 2013; Honea et al., 2005), welche jedoch im Gegensatz zu klinischen Befunden heterogenere Beziehungen aufweisen. Im subklinischen Bereich ließen sich zudem Abweichungen der kortikalen Faltung feststellen (Fonville et al., 2019; Liu et al., 2016), welche einen kontinuierlichen Zusammenhang mit entwicklungsbedingten Faktoren erkennen lassen. Die modifizierenden Eigenschaften von schizotypen Traits und der Belastung durch perzeptuelle Auffälligkeiten auf jeweils positive und negative Zusammenhänge in hippocampalen und präfrontalen Strukturen deuten darauf hin, dass innerhalb des Psychose-Kontinuum möglichweise nichtlineare kortikale Veränderungen stattfinden (Bartholomeusz et al., 2017; Binbay et al., 2012; Johns & van Os, 2001).
 Publikationsserver
Publikationsserver