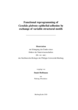Functional reprogramming of Candida glabrata epithelial adhesins by exchange of variable structural motifs
The yeast Candida glabrata is part of the human microbiome and usually employs a commensal lifestyle, but this fungus is also able to act as an opportunistic pathogen, causing localized as well as severe systemic infections. For host invasion and dissemination, C. glabrata disposes of a large number...
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2020
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Der Hefepilz Candida glabrata ist Teil des menschlichen Mikrobioms und zeigt üblicherweise eine kommensale Lebensweise. Dieser Pilz ist aber auch in der Lage, als opportunistischer Erreger zu wirken und lokale sowie schwere systemische Infektionen zu verursachen. Für das Eindringen in den Wirt und die weitere Ausbreitung verfügt C. glabrata über eine große Anzahl zellwandgebundener Proteine, von denen die epithelialen Adhäsine (Epas) die bekanntesten sind. Die Epa-Familie umfasst mehr als 20 Mitglieder, die als Lektine wirken. Alle Epa-Paraloge besitzen die dreiteilige Architektur pilzlicher Adhäsine mit einer N-terminalen A-Domäne (Adhäsionsdomäne) und einer zentralen B-Domäne, die aus einer variablen Anzahl von serin- und threonin-reichen Wiederholungen besteht. Die C-terminale Region trägt einen Glycosylphosphatidylinositol (GPI)-Anker zur Befestigung an der Zellwand. Die Lektinfunktion von Epa-Adhäsinen wird durch eine Kombination von konservierten und variablen Strukturelementen innerhalb ihrer A-Domäne bestimmt. Zusammen bilden diese Elemente eine innere und äußere Bindetasche und kontrollieren voraussichtlich die Affinität und Spezifität der Ligandenbindung. In dieser Arbeit wurden variable Strukturelemente mehrerer Epa-Paraloge mit Hilfe einer strukturbasierten Mutationsanalyse funktionell charakterisiert, um ihre Rolle bei der Vermittlung der Wirtszelladhäsion und der Spezifität der Ligandenbindung aufzuklären. Zu diesem Zweck wurde eine Reihe chimärer EpaA-Varianten konstruiert und funktionell charakterisiert, in denen hochvariable Regionen der inneren und äußeren Bindetasche ausgetauscht wurden. In-vivo-Adhäsionsassays mit menschlichen Epithelzellen zeigten, dass diese beiden Strukturelemente an der Wirtszellbindung beteiligt sind. Insbesondere führten Austausche innerhalb der inneren Bindetasche zu einer verringerten Bindungsstärke. Im Gegensatz dazu zeigte der Austausch verlängerter Schleifen in der äußeren Bindetasche gegen kürzere Varianten eine signifikante Zunahme der Wirtszelladhäsion, während Chimären, die längere statt einer kürzeren Schleife trugen, eine geringere Adhäsion aufwiesen. Die chimären EpaA-Varianten wurden anschließend durch Glykanarray-Analyse und Fluoreszenztitrationsspektroskopie charakterisiert. Diese Messungen zeigten, dass die Ligandenbindungsspezifität der EpaA-Domänen prinzipiell durch Austausch von Strukturelementen in der inneren Bindetasche umprogrammiert werden kann, allerdings mit begrenzter Vorhersagbarkeit. Im Gegensatz dazu hatte der Austausch von Elementen in der äußeren Bindetasche im Allgemeinen keinen Einfluss auf die Ligandenbindungsmuster. Zur weiteren strukturellen Charakterisierung der verlängerten Schleifen in der äußeren Bindetasche wurden Soaking-Versuche mit Proteinkristallen und komplexen Glykanen durchgeführt. Da dieser Ansatz keine strukturellen Daten lieferte, wurde die Flexibilität der verlängerten Schleifen durch Molekulardynamiksimulationen analysiert, um eine vermutete Deckelfunktionalität zu testen. Diese Simulationen zeigen, dass in Abwesenheit von Glykanliganden die verlängerte Schleife prinzipiell eine stabile Konformation annehmen kann, aber die Bindetasche nicht bedeckt. In Gegenwart eines tetrameren Glykans wurde jedoch das reduzierende Ende des Liganden durch direkten Kontakt mit der Schleife stabilisiert, was auf eine wichtige Funktion dieses variablen Strukturelements bei der Bindung komplexer Glykanstrukturen hinweist. In einem weiteren Teil dieser Arbeit wurde die Funktion variabler Aminosäurereste innerhalb der inneren Bindetasche untersucht, für die postuliert wurde, dass sie für eine spezifische Bindung von sulfatierten Glykanen verantwortlich sind. Um diese Hypothese zu überprüfen, wurden entsprechende Auminosäuren durch Mutationsanalyse in Kombination mit in-vivo-Adhäsionstests an humanen Epithelzellen und in-vitro-Ligandenbindungsstudien funktionell charakterisiert. Interessanterweise wurde keine Korrelation zwischen den mutierten Positionen und spezifischer Sulfoglykanbindung festgestellt. Bindungssimulationen mit sulfatierten Disaccharidliganden deuten jedoch darauf hin, dass andere sterische Effekte die spezifische Bindung von räumlich anspruchsvollen Sulfatgruppen in EpaA-Domänen kontrollieren. Zusammenfassend unterstützen die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse die Annahme, dass die Variation verschiedener Strukturelemente in der inneren und äußeren Ligandenbindetasche der EpaA-Adhäsine ein Hauptfaktor für ihre funktionelle Diversifizierung und Evolution ist.
 Publikationsserver
Publikationsserver