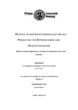Defizite in der Emotionsregulation als Prädiktor für Depressionen und Angststörungen
Eine Vielzahl von Studien belegen die Wirksamkeit von psychotherapeutischen Methoden bei Major Depression und Angststörungen. Trotz der Verfügbarkeit von evidenzbasierten pharmakologischen sowie psychotherapeutischen Behandlungsansätzen führen diese bei einer großen Zahl von Patienten nach Therapiee...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Beteiligte: | |
| Format: | Dissertation |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2015
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | PDF-Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Eine Vielzahl von Studien belegen die Wirksamkeit von psychotherapeutischen Methoden bei Major Depression und Angststörungen. Trotz der Verfügbarkeit von evidenzbasierten pharmakologischen sowie psychotherapeutischen Behandlungsansätzen führen diese bei einer großen Zahl von Patienten nach Therapieende zu keiner vollständigen Remission, sondern zu einer erheblichen Residualsymptomatik. Zudem deuten erste Befunde darauf hin, dass es nach Abschluss der Therapie eine klinisch bedeutsame Anzahl von Rückfällen gibt und darüber hinaus häufig chronische Verläufe von Erkrankungen zu verzeichnen sind. Zusammengenommen sprechen diese Befunde für eine weiterhin eingeschränkte kurz- und langfristige Effektivität der eingesetzten Behandlungskonzepte für Depressionen und Angststörungen. Aktuelle systematische Übersichtsarbeiten postulieren einen engen Zusammenhang zwischen einer defizitären Emotionsregulation und affektiven Störungen, wobei es weiterhin an prospektiven Studien, insbesondere im Verlauf von psychotherapeutischen Behandlungen, mangelt. Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich daher mit einer möglichen Verbesserung der gängigen Therapieverfahren und beleuchtet hierbei die Emotionsregulation als einen potentiellen Wirkfaktor in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen und Angststörungen.
In den hier dargestellten Studien 1 und 2 werden die längsschnittlichen reziproken Zusammenhänge von emotionaler Kompetenz und Ängstlichkeit bzw. Depressivität über einen Zeitraum von fünf Jahren untersucht. Darüberhinaus werden die reziproken Zusammenhänge zwischen den spezifischen Emotionsregulationsstrategien (Berking 2015; Berking & Whitley, 2014) und diesen Symptombereichen exploriert. So konnte in Studie 1 und Studie 2 aufgezeigt werden, dass die emotionale Kompetenz nicht nur die nachfolgende Ängstlichkeit, sondern auch die Depressivität fünf Jahre nach der Baseline-Erfassung vorhersagt. Mittels Cross-lagged-Panel Analysen wurde zudem gezeigt, dass die umgekehrte Wirkrichtung von Ängstlichkeit bzw. Depressivität auf die nachfolgende emotionale Kompetenz keine signifikanten Effekte erzielt. Zudem zeigen die explorativen Untersuchungen zum Zusammenhang von emotionaler Kompetenz und Ängstlichkeit, dass insbesondere die spezifischen Emotionsregulationsstrategien der Akzeptanz und Toleranz, der Konfrontationsbereitschaft sowie der Klarheit im Erkennen affektiver Zustände die wichtigsten Prädiktoren für die nachfolgende Ängstlichkeit sind. Ein Vergleich der Effektstärken der spezifischen Emotionsregulationsstrategien für die nachfolgende Depressivität ergibt, dass alle verwendeten Strategien von ähnlicher Relevanz sind. Zusammenfassed zeigen die Studien 1 und 2 somit die Bedeutung der emotionalen Kompetenz für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Ängstlichkeit und Depressivität in einer nichtklinischen Stichprobe auf.
In Studie 3 wurde der wechselseitige Zusammenhang zwischen der emotionalen Kompetenz und der Depressivität, Ängstlichkeit und des allgemeinen Disstress im Verlauf der ersten drei Behandlungswochen einer stationären Therapie untersucht. Hierzu wurden moderne Strukturgleichungsmodelle (Latent Change Score Modelle) eingesetzt, um die Veränderung in der Psychopathologie auf die Veränderung der Emotionsregulation in der vorherigen Woche zurückzuführen oder den entgegengesetzten Wirkmechanismus empirisch zu belegen. Im Verlauf einer stationären Depressionsbehandlung zeigte sich, dass eine verbesserte emotionale Kompetenz mit einer nachfolgenden Reduktion der Depressivität einherging. Dieser Wirkzusammenhang konnte im stationären Kontext jedoch nicht für die Ängstlichkeit und das pathologische Stresserleben der Patienten aufgezeigt werden.
Zusammengefasst liefert die vorliegende Dissertation somit Hinweise, dass (1) eine defizitäre emotionale Kompetenz die Entstehung und Aufrechterhaltung von Ängsten und Depressivität in einer nicht klinischen Stichprobe begünstigt, (2) während einer stationären Psychotherapie adaptivere emotionale Kompetenzen zu einer Reduktion der Depressivität führen. Somit könnte eine systematische Verbesserung der emotionalen Kompetenzen ein relevantes Behandlungsziel darstellen, das die Standardinterventionen zur Behandlung von Major Depression ergänzt und (3) die transdiagnostische Relevanz von adaptiven emotionalen Kompetenzen im Verlauf der stationären Therapie in zukünftigen Studien differenzierter beleuchtet werden muss. |
|---|---|
| DOI: | 10.17192/z2015.0413 |
 Publikationsserver
Publikationsserver